
umwelt-online: Archivdatei - GFK 2014 - Gemeinsamer Fragenkatalog der Länder für die Sachkundeprüfung nach § 5 der Chemikalien-VerbotsV (3)
| zurück |  |
II 4 79
Epoxidharzverarbeitung gefährdet vorrangig
a die Leber als Hauptstoffwechselorgan.
b das Nervensystem.
c Haut- und Schleimhäute.
d die Atemwege.
II 4 80
Welches der genannten Lösungsmittel kann nach der Aufnahme entsprechender Mengen zu Müdigkeit oder Bewusstlosigkeit führen?
a Aceton
b Toluol
c Ethanol
d Benzol
II 4 81
Wozu wird Oxalsäure verwendet?
a Oxidieren und Nitrieren chemischer Verbindungen
b Rost- und Tintenfleckentferner
c Herstellung von Düngemitteln
d Bleichen von Stroh, Holz und Kork
II 4 82
Oxalate
a werden als Rost- und Tintenfleckenentferner verwendet.
b zersetzen sich im Gemisch mit organischen Substanzen explosionsartig.
c finden sich in der Natur in bestimmten Pflanzen.
d finden als "Höllenstein" Verwendung.
II 4 83
Welcher Stoff ist nach Anhang VI RL 67/548/EWG als hochentzündlich eingestuft?
a Ätznatron
b Flusssäure
c Cyanwasserstoff
d Diethylether
II 4 84
Welcher Stoff wäre mit diesem Schild richtig gekennzeichnet? (Nur eine Antwort ist richtig)
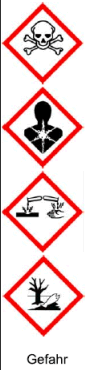 |
(612-008-00-7)
zur Analyse Gehalt > 99 % |
|
|
| Kann vermutlich Krebs erzeugen. | H351 | ||
| Kann vermutlich genetische Defekte verursachen. | H341 | ||
| Giftig bei Einatmen. | H331 | ||
| Giftig bei Hautkontakt. | H31 1 | ||
| Giftig bei Verschlucken. | H301 | ||
| Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. | H372 | ||
| Verursacht schwere Augenschäden. | H318 | ||
| Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H317 | ||
| Sehr giftig für Wasserorganismen. | H400 | ||
| Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P273 | ||
| Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P280 | ||
| BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P308+P313 | ||
| BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. | P302+P352 | ||
| BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P305+P351+P338 | ||
| BEI Exposition oder Unwohlsein: Sofort GIFTINFORMATIONS-ZENTRUM oder Arzt anrufen. (Keine offizielle P-Satzkombination) | P309+P310 | ||
| Firma Mustermann AG Firmenstraße 3 80200 München +49(0) 89 12345 |
1 Liter | ||
a Anilin
b Methanol
c Trichlorethen
d Tetrachlorethen
II 4 85
Welche Eigenschaft besitzen Isocyanate?
a Gesundheitsschädlich beim Einatmen
b Verdacht auf krebserzeugende Wirkung
c Sie haben ätzende Eigenschaften
d Reizen die Augen, die Atmungsorgane und die Haut
II 4 86
Welche Gefahr geht vom Treibmittel bei der Verwendung von PU-Montageschäumen aus Aerosoldosen aus?
a Keine, da es sich bei dem Treibmittel in der Regel um ein inertes Gas handelt.
b Als Treibmittel werden in der Regel hochentzündliche Gase (z.B. Propan) verwendet. Deshalb besteht bei unsachgemäßer Verwendung Brand- und Explosionsgefahr.
c Bei der Schaumbildung reagiert das Treibmittel vollständig mit dem Präpolymer, so dass weder Brand- noch Explosionsgefahr besteht.
d Keine, das Treibmittel verbleibt in der Aerosoldose, da das Treibmittel das Präpolymer lediglich aus der Dose verdrängt.
II 4 87
Wozu werden isocyanathaltige Montageschäume bestimmungsgemäß verwendet?
a Befestigung und beim Einbau von Fenstern und Türen.
b als feuerbeständige Abtrennung eines Brandabschnittes.
c zur Abdichtung von Hochdruckleitungen.
d zur Wärmeisolierung.
II 4 88
Bei der Verwendung von isocyanathaltigen Montageschäumen
a ist Hautkontakt zu vermeiden.
b ist bei unzureichender Lüftung Atemschutz anzuwenden.
c ist Lichteinwirkung zu meiden.
d ist eine dichtschließende Schutzbrille zu verwenden.
II 4 89
Für welchen Stoff oder für welche Stoffe, die bei der Herstellung von Polyurethanschäumen im Reaktionsgemisch vorliegen, sind im Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-VO) Beschränkungsbedingungen festgelegt?
a bei keinem der Inhaltsstoffe
b bei Propan
c bei allen Isocyanaten
d bei Methylendiphenyl-Diisocyanat (MDI)
II 4 90
MDI ist die Abkürzung für welche Verbindung im Gemisch?
a Toluol-2,4-diisocyanat
b Diphenylmethandiisocyanat
c Methylendiphenyl-Diisocyanat
d Diaminodiphenylmethan
II 4 91
Welche gefährliche Eigenschaft bezeichnet der Ausdruck karzinogen?
a wassergefährdend
b krebserzeugend
c fruchtschädigend
d erbgutverändernd
II 4 92
Welchen Hinweis geben Sie dem Kunden zur Entsorgung gebrauchter PU-Dosen? Entleerte Dosen können
a in den Hausmüll gegeben werden.
b bei der Schadstoffsammelstelle abgegeben werden.
c beim Händler abgegeben werden.
d in den gelben Sack gegeben werden.
II 4 93
Montageschäume, bei denen die Konzentration von MDI> 0,1 Gew.-% beträgt, dürfen seit dem 27. Dezember 2010 nur dann an die breite Öffentlichkeit abgegeben werden, wenn
a der Erwerber eine Ausbildung zum Trockenbauer absolviert hat.
b der Lieferant gewährleistet, dass die Verpackung Schutzhandschuhe enthält.
c auf der Verpackung gut sichtbar, leserlich und unverwischbar die Aufschrift steht: "Das Produkt nicht bei ungenügender Lüftung verwenden oder Schutzmaske mit entsprechendem Gasfilter (Typ A1 nach EN 14387) tragen."
d der Erwerber über eine erforderliche Sachkunde verfügt.
II 4 94
Montageschäume, bei denen die Konzentration von MDI> 0,1 Gew.-% beträgt, dürfen seit dem 27. Dezember 2010 nur dann an die breite Öffentlichkeit abgegeben werden, wenn
a der Erwerber eine Ausbildung zum Tischler absolviert hat.
b der Lieferant gewährleistet, dass die Verpackung Schutzhandschuhe enthält.
c auf der Verpackung gut sichtbar, leserlich und unverwischbar die Aufschrift steht:
"Bei Personen, die bereits für Diisocyanate sensibilisiert sind, kann der Umgang mit diesem Produkt allergische Reaktionen auslösen."
d auf der Verpackung gut sichtbar, leserlich und unverwischbar die Aufschrift steht: "Das Produkt nicht bei ungenügender Lüftung verwenden oder Schutzmaske mit entsprechendem Gasfilter (Typ A1 nach EN 14387) tragen."
II 4 95
Welche Maßnahme der Ersten Hilfe ist nach Kontakt mit reaktiven MDI-haltigen Montageschäumen einzuleiten?
a Kontaminierte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen
b Betroffene Hautpartien mit Wasser und Seife abwaschen
c Nach Verschlucken Erbrechen einleiten
d Nach Augenkontakt sofortige anhaltende Spülung mit viel fließendem Wasser, Facharzt aufsuchen
GFK II Nr. 5 - Möglichkeiten der Gefahrenabwehr
II 5 1
Welche Aufgabe hat ein Arbeitgeber, bevor er Arbeitnehmer mit den Gefahrstoffen umgehen lässt?
a Er muss prüfen, ob von den zur Verwendung vorgesehenen Stoffen oder Gemische eine Gefährdung für die Gesundheit oder die Sicherheit der Beschäftigten ausgehen kann. Hierzu ist auch ein Verzeichnis der im Betrieb verwendeten Gefahrstoffe zu führen.
b Der Arbeitgeber hat von fachkundigen Personen eine Gefährdungsbeurteilung durchführen zu lassen, in der mögliche auftretende Gefährdungen beschrieben und die Wirksamkeit der getroffenen oder zu treffenden Schutzmaßnahmen beurteilt wird.
c Bei mehr als 5 Beschäftigten ist die Gefährdungsbeurteilung zu dokumentieren. Treten nur geringe Gefährdungen auf, kann die Dokumentation in einer vereinfachten Form durchgeführt werden.
d Arbeitnehmer müssen vor der Aufnahme einer Tätigkeit mit Gefahrstoffen anhand einer Betriebsanweisung über auftretende Gefährdungen und entsprechende Schutzmaßnamen unterwiesen werden.
II 5 2
Welche Ermittlungspflicht hat der Arbeitgeber bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen?
a Er hat keine Ermittlungspflicht bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen.
b Vor Aufnahme der Arbeit mit Gefahrstoffen sind die mit den Tätigkeiten verbundenen Gefahren zu ermitteln und zu beurteilen.
c Schutzmaßnahmen sind in der Regel nicht notwendig.
d Er hat ein Verzeichnis aller im Betrieb vorhandenen Gefahrstoffe zu führen, außer es treten nur geringe Gefährdungen auf.
II 5 3
Der Ersatz von Gefahrstoffen zur Beseitigung von Gefährdungen der Gesundheit und Sicherheit von Beschäftigten bei der Arbeit ist vorgeschrieben
a bei Überschreitung einer bestimmten Beschäftigtenzahl.
b nur nach Anordnung durch das Gewerbeaufsichtsamt.
c wenn ein weniger gefährlicher Stoff verfügbar und dessen Verwendung zumutbar ist.
d auch ohne Begründung, wenn die Arbeitnehmer sie einklagen.
II 5 4
Ersatzstoffprüfung ist
a auch in Hochschulen durchzuführen.
b ist eine durch das Bundes-Immissionsschutzgesetz vorgeschriebene Prüfung.
c ist eine zentrale Forderung der Chemikalien-Verbotsverordnung.
d ist anerkannte Praxis auf Grund einschlägiger Vorschriften der Berufsgenossenschaften.
II 5 5
Welche Ermittlungspflicht hat der Arbeitgeber bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen?
a Er muss prüfen, ob es für den gleichen Zweck Stoffe mit geringerem gesundheitlichen Risiko gibt.
b Vor Aufnahme der Arbeit mit Gefahrstoffen sind die mit den Tätigkeiten verbundenen Gefahren zu ermitteln und zu beurteilen.
c Er hat auch zu regeln, welche Schutzmaßnahmen zur Gefahrenabwehr zu treffen sind.
d Er soll alle Arbeitnehmer vom Betriebsarzt auf ihre gesundheitliche Tauglichkeit überprüfen lassen.
II 5 6
Welche Aussage zu Tätigkeiten mit Gefahrstoffen trifft zu?
a Der Arbeitgeber hat sich zu vergewissern, ob es sich im Hinblick auf die vorgesehenen Tätigkeiten um Gefahrstoffe handelt.
b Der Arbeitgeber erhält die notwendigen Informationen aus der Kennzeichnung, dem Sicherheitsdatenblatt oder anderen ohne weiteres zugänglichen Quellen.
c Der Arbeitgeber hat zu regeln, welche Maßnahmen zur Abwehr der Gefahren zu treffen sind, die bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen entstehen können.
d Die Arbeitnehmer sind berechtigt, die Arbeit zu verweigern, wenn der Arbeitgeber Gefahrstoffe nicht durch weniger gefährliche Chemikalien ersetzt.
II 5 7
Wer ist zur Prüfung gem. § 6 Abs. 1 GefStoffV, ob Stoffe mit geringerem gesundheitlichen Risiko eingesetzt werden können, verpflichtet?
a der Einführer
b der Hersteller
c der Anwender
d der Arbeitgeber
II 5 8
Wie können Sie sich über notwendige Arbeitschutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen orientieren?
a Durchlesen des Sicherheitsdatenblattes
b Durchlesen des Atemschutzmerkblattes der Berufsgenossenschaft
c Einbeziehung der Fachkraft für Arbeitssicherheit
d Besprechung mit dem Betriebsarzt
II 5 9
Welche Pflicht hat der Arbeitgeber bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden Gefahrstoffen?
a Er muss, falls möglich, Stoffe mit geringerem gesundheitlichen Risiko einsetzen, allerdings nur, wenn dies nicht die Änderung des Verwendungsverfahrens erfordert.
b Er muss die Gefahren nach Art, Ausmaß und Dauer der Exposition der Arbeitnehmer beurteilen und bei maßgeblichen Veränderungen oder aufgrund von Ergebnissen der arbeitsmedizinischen Vorsorge die Gefährdungsbeurteilung aktualisieren.
c Er hat den Zutritt zu Arbeitsbereichen, in denen mit krebserzeugenden Stoffen umgegangen wird, nur den dort tätigen Arbeitnehmern zu gestatten.
d Es sind alle Maßnahmen entsprechend "Besondere Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden, erbgutverändernden und fruchtbarkeitsgefährdenden Gefahrstoffen" durchzuführen.
II 5 10
Die Lagerung von giftigen Stoffen hat zu erfolgen:
a unter Verschluss und vom "Sachkundigen für Lagerung von Giften"
b unter Verschluss oder so, dass nur fachkundige Personen Zutritt haben
c generell getrennt von Stoffen mit anderen Gefährlichkeitsmerkmalen
d ab bestimmten Lagermengen gemäß TRGS 510
II 5 11
Welche Gefahrstoffe müssen unter Verschluss aufbewahrt werden oder so, dass nur fachkundige Personen Zugang haben?
a Gifte mit dem Kennbuchstaben Xn oder Xi
b nur Pflanzenschutzmittel
c Gefahrstoffe mit dem Kennbuchstaben T oder T+
d prinzipiell alle Gefahrstoffe
II 5 12
Welche Aussage ist richtig?
a Gefahrstoffe sind so aufzubewahren, dass sie die menschliche Gesundheit und die Umwelt nicht gefährden.
b Die Lagerung von Gefahrstoffen in unmittelbarer Nähe von Arznei-, Lebens- und Futtermitteln ist erlaubt, wenn bei diesen keine Qualitätsveränderungen auftreten.
c Stoffe und Gemische, die als giftig gekennzeichnet sind, dürfen Betriebsfremden nicht zugänglich sein.
d Die Bestimmungen der Gefahrstoffverordnung gelten auch für die Aufbewahrung von Gefahrstoffen im Haushalt.
II 5 13
Die Aufbewahrung und Lagerung von Gefahrstoffen muss so erfolgen, dass
a die menschliche Gesundheit und die Umwelt nicht gefährdet werden.
b ein Missbrauch verhindert wird.
c Lebensmittel, Futtermittel und Arzneimittel nicht beeinträchtigt werden.
d nur Beauftragte nach § 3 Abs. 2 ChemVerbotsV Zugang zu den gelagerten Gefahrstoffen haben.
II 5 14
Wie sind sehr giftige und giftige Stoffe und Gemische in Kleinbetrieben und Verkaufsstellen mit weniger als 5 Beschäftigten zu lagern?
a Unter Verschluss oder
b so, dass nur fachkundige Personen Zugang haben.
c Die Aufbewahrung von Kleinstmengen in Lebensmittelbehältern kann geduldet werden, sofern diese vorschriftsmäßig gekennzeichnet sind.
d So, dass die menschliche Gesundheit und die Umwelt nicht gefährdet werden.
II 5 15
Wie müssen giftige Stoffe gelagert werden?
a Sie müssen so gelagert werden, dass sie die menschliche Gesundheit und die Umwelt nicht gefährden.
b Sie dürfen wie alle Gefahrstoffe nicht in Behältnissen aufbewahrt werden, durch deren Form oder Bezeichnung der Inhalt mit Lebensmitteln verwechselt werden kann.
c Sie dürfen nicht mit Medikamenten zusammengelagert werden.
d Giftige und sehr giftige Gefahrstoffe sind unter Verschluss aufzubewahren oder so aufzubewahren, dass nur fachkundige Personen Zugang haben.
II 5 16
Wie sind Restmengen und Abfälle von krebserzeugenden Gefahrstoffen (Kennzeichnung R 45 oder R 49) oder die krebserzeugende Gefahrstoffe enthalten zu sammeln, zu lagern oder zu entsorgen?
a Es gibt keine Vorschriften, da die Gefahrstoffverordnung für Abfälle nicht gilt.
b Restmengen und Abfälle müssen vom Händler an den Hersteller zurückgegeben werden.
c Diese Stoffe sind in geeigneten, sicher verschließbaren und gekennzeichneten Behältern zu sammeln, zu lagern und zu entsorgen.
d Restmengen und Abfälle gehören in die Mülltonne.
II 5 17
Welche Aussage ist richtig?
a Mit F oder E gekennzeichnete Gefahrstoffe sind unter Verschluss oder so aufzubewahren, dass nur fachkundige Personen Zugang haben.
b leichtentzündliche Lösemittel dürfen auch dann nicht in Sprudelflaschen aufbewahrt werden, wenn diese ordnungsgemäß nach GefStoffV gekennzeichnet sind.
c Arbeitnehmer, die mit ätzenden Stoffen umgehen, müssen vor Aufnahme ihrer Tätigkeit einer Vorsorgeuntersuchung unterzogen werden.
d Krebserzeugende Gefahrstoffe der Kategorie 1 oder 2 sind unter Verschluss oder so aufzubewahren, dass nur fachkundige Personen Zugang haben.
II 5 18
Bestimmte Gefahrstoffe sind so zu lagern, dass nur fachkundige Personen Zugang haben. Dies gilt unter anderem für:
a Giftige Gefahrstoffe
b Ätzende Gefahrstoffe
c Hochentzündliche Gefahrstoffe
d Brandfördernde Gefahrstoffe
II 5 19
Welche Aussage ist richtig?
a Zur Lagerung von giftigen Stoffen ist ein "Giftschrank" unbedingt erforderlich.
b Giftige und gesundheitsschädliche Stoffe müssen unter Verschluss aufbewahrt werden.
c Wenn gewährleistet ist, dass allein fachkundige und zuverlässige Personen Zugang zu giftigen Stoffen haben, müssen diese nicht unter Verschluss gelagert werden.
d Giftige Stoffe dürfen sich nur bis zur Höhe der für den Fortgang der Tätigkeit erforderlichen Menge am Arbeitsplatz befinden.
II 5 20
Welche Gefahrstoffe sind unter Verschluss zu lagern?
a krebserzeugende Gefahrstoffe der Kategorie 1
b krebserzeugende Gefahrstoffe der Kategorie 2
c krebserzeugende Gefahrstoffe der Kategorie 3
d giftige Gefahrstoffe
II 5 21
Welcher Sicherheitsratschlag ist beim Umgang mit MDI-haltigen Montageschäumen zu beachten?
Verwenden Sie hierfür die beigefügte Stoffliste!
a Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen (S23)
b Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen (S33)
c Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen (S36/37)
d Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen) (S45)
II 5 22
Welche hygienische Vorsichtsmaßnahme gilt bei Tätigkeiten mit (sehr) giftigen, krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder erbgutverändernden Gefahrstoffen?
a Nahrungs- und Genussmittel dürfen mit diesen Gefahrstoffen nicht in Berührung kommen.
b An den Arbeitsplätzen dürfen die Arbeitnehmer keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen.
c Für die Arbeitnehmer immer sind Waschräume zur Verfügung zu stellen.
d Schutzkleidung ist vom Arbeitgeber zur Verfügung zu stellen und deren Reinigung zu veranlassen.
II 5 23
Welche hygienische Vorsichtsmaßnahme gilt bei Tätigkeiten mit (sehr) giftigen, krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder erbgutverändernden Gefahrstoffen?
a Lebensmittel und Tabakerzeugnisse dürfen mit diesen Gefahrstoffen nicht in Berührung kommen.
b An den Arbeitsplätzen darf nicht gegessen, getrunken, geraucht oder geschnupft werden.
c Für die Arbeitnehmer sind Räume mit getrennten Aufbewahrungsmöglichkeiten für Straßen- und Arbeitskleidung zur Verfügung zu stellen.
d Die Arbeitnehmer haben ständig eine persönliche Schutzausrüstung (Handschuhe, Atemschutzmaske und Schutzanzug) zu tragen.
II 5 24
Was müssen Arbeitnehmer beachten, die mit sehr giftigen oder giftigen Stoffen umgehen?
a Es gibt keine besonderen Vorschriften im Vergleich zu anderen Gefahrstoffen.
b Essen, Trinken, Rauchen und Schnupfen ist in den Arbeitsräumen verboten.
c An den betroffenen Arbeitsplätzen sind keine Zimmerpflanzen erlaubt.
d Das Vesperbrot muss so aufbewahrt werden, dass es mit den Gefahrstoffen nicht in Berührung kommt.
II 5 25
Darf bei Tätigkeiten mit giftigen Stoffen gegessen, getrunken, geraucht oder geschnupft werden?
a nein
b Essen und Trinken sind nicht erlaubt, Rauchen ist erlaubt.
c Alkoholfreie Getränke sind erlaubt.
d Nur Rauchen ist zu unterlassen, da ohnehin schädlich.
II 5 26
An Arbeitsplätzen, an denen mit Gefahrstoffen umgegangen wird, die folgende gefährliche Eigenschaften besitzen, ist der Konsum von Nahrungs- und Genussmitteln nicht zulässig:
a giftig
b sensibilisierend
c erbgutverändernd
d krebserzeugend
II 5 27
Beim Umgang mit Farben, die organische Lösungsmittel enthalten,
a ist die Schadstoffaufnahme auch über die Haut möglich.
b sind die Atemwege Hauptaufnahmeweg.
c kann bei hohen Konzentrationen notfalls auch ein Schutzfilter für Säuren verwendet werden.
d kann ein Aktivkohlefilter die organischen Lösungsmittel wirksam zurückhalten.
II 5 28
Ergibt die Gefährdungsbeurteilung eine größere als nur "geringe Gefährdung"
a sind weitere Maßnahmen nach den Abschnitt 4 der GefStoffVzu treffen.
b müssen Signalgeber am Arbeitsplatz ansprechen.
c kommt eine durch den Stoff ausgelöste Krankheit zum Ausbruch.
d kann die Arbeit eingestellt werden.
II 5 29
Welche Aussage ist richtig?
a Gefährdungsbeurteilungen dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden.
b Atemschutzgeräte als persönliche Schutzausrüstung ersetzen mögliche betriebstechnische und organisatorische Maßnahmen.
c Belastende Atemschutzgeräte dürfen zeitlich unbegrenzt getragen werden, wenn ein ermächtigter Arzt dem Träger die gesundheitliche Eignung bestätigt hat.
d Bei Feuchtarbeiten von regelmäßig 4 Stunden oder mehr pro Tag ist eine Tauglichkeitsuntersuchung Voraussetzung für die Beschäftigung oder Weiterbeschäftigung.
II 5 30
Jeder Arbeitgeber ist verpflichtet, eine Gefährdungsbeurteilung für alle Gefahrstoffe, mit denen seine Arbeitnehmer umgehen, durchzuführen. Welche Angabe muss die Gefährdungsbeurteilung u.a. enthalten?
a Bezeichnung der Gefahrstoffe und gefährlichen Eigenschaften der Stoffe oder Gemische
b Arbeitsbedingungen und Wirksamkeit der getroffenen oder zu treffenden Schutzmaßnahmen
c Mengenbereiche der Gefahrstoffe im Betrieb
d Höhe und Dauer der Exposition
II 5 31
Bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen können Vorsorgeuntersuchungen nötig werden. Sie müssen durchgeführt werden
a bei jedem Arbeitnehmer vor Aufnahme der Beschäftigung.
b bei Arbeiten mit den in der "Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge" ( ArbMedVV) § 4 Anhang Teil 1 (1) genannten Gefahrstoffen, wenn der Arbeitsplatzgrenzwert überschritten wird.
c bei Gefahr von Gesundheitsschäden durch Hautkontakt mit hautresorptiven Stoffen aus ArbMedVV Anhang Teil 1 (1).
d bei einer arbeitsbedingten Erkrankung durch Tätigkeiten mit Gefahrstoffen.
II 5 32
Der Sicherheitsratschlag S 33 empfiehlt, Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung zu treffen. Wie können Sie diesem Ratschlag nachkommen?
a Beim Abfüllen ein Erdungskabel verwenden.
b Nur Metallgeräte verwenden.
c Nur Kunststoffgefäße verwenden.
d Nur Kunststofftrichter verwenden.
II 5 33
Sie nehmen Aufgaben des Arbeitgebers in einem Betrieb wahr, in dem mit gefährlichen Stoffen umgegangen wird, die Sie von einem Hersteller oder Einführer beziehen. Welche der folgenden Maßnahmen sind von Ihnen durchzuführen?
a Gefährdungsbeurteilung durchführen und dokumentieren.
b Dafür zu sorgen, dass einmal jährlich alle Mitarbeiter des Betriebes eine ärztliche Vorsorgeuntersuchung erhalten.
c Dafür zu sorgen, dass neuerlich bekannt gewordene Gefahren der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) unverzüglich mitgeteilt werden.
d Betriebanweisungen erstellen und nachweislich unterweisen.
II 5 34
Sie erhalten den Auftrag, ein so genanntes Gefahrstoffkataster, d. h. das in § 6 Abs. 10 Gefahrstoffverordnung vorgesehene Verzeichnis, für den Betrieb als sachverständiger Chemiker zu erstellen. Welche Angabe muss in dem Verzeichnis mindestens enthalten sein?
a Die Kennzeichnung (Einstufung) aller Gefahrstoffe, mit denen die Arbeitnehmer umgehen.
b Die Arbeitsbereiche, in denen mit Gefahrstoffen umgegangen wird.
c Die Lieferanten, von denen die Gefahrstoffe regelmäßig bezogen werden.
d Der tägliche Verbrauch der regelmäßig verwendeten Gefahrstoffe.
II 5 35
Der Sicherheitsratschlag S 33 empfiehlt: "Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen". Wie können Sie diesem Ratschlag nachkommen?
a Nur Geräte aus Polyethylen oder PVC verwenden.
b Nur geerdete Metallgeräte verwenden.
c Alle Flüssigkeit mit 5 % Wasser versetzen.
d Rundfunkgeräte ausschalten.
II 5 36
Das Quecksilber-Thermometer einer Kundin ist auf dem Zimmerboden zerbrochen. Sie will Rat von Ihnen. Sie sagen ihr, dass
a metallisches Quecksilber nicht verdampft und daher für den Menschen nicht giftig ist.
b sie das Quecksilber mit dem Föhn bei geöffneten Fenstern verdampfen soll.
c sie das Quecksilber möglichst vollständig aufnehmen und bei einer Schadstoffsammelstelle entsorgen soll.
d das Quecksilber Löcher in den Zimmerboden frisst.
GFK II Nr. 6 - Vertiefte Kenntnisse der ChemVerbotsV / REACH-VO Nr. 1907/2006
II 6 1
Für welche der nachfolgend aufgeführten gefährlichen Stoffe / Stoffgruppen enthält die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-VO) Beschränkungen für das Inverkehrbringen?
a Asbest
b Benzol
c Aromatische Amine
d Bleiverbindungen
II 6 2
Welchen Massengehalt an Formaldehyd dürfen Wasch-, Reinigungs- und Pflegemittel beim Inverkehrbringen aufweisen?
a überhaupt keinen
b bis zu 2 %
c bis 0,2 %
d bis 0, 1 %
II 6 3
Kreuzen Sie den Gefahrstoff an, für den Verbote bzw. Beschränkungen für das Inverkehrbringen existieren.
a Formaldehyd
b Asbest
c polychlorierte Dioxine
d Kupfersulfat
II 6 4
Kreuzen Sie den Gefahrstoff an, für den Verbote bzw. Beschränkungen nach Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-VO) für das Inverkehrbringen existieren.
a Benzol
b Ammoniak
c Aromatische Amine
d Cadmium
II 6 5
Welches Produkt darf nach Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-VO) in den Verkehr gebracht werden?
a Treibstoffe mit einer Konzentration von < 0,1 Gew.-% Benzol
b Klebstoffe mit einer Konzentration von < 0,1 Gew.-% Toluol
c Farben auf der Basis von neutralem Bleikarbonat, die zur Erhaltung von Kunstwerken bestimmt sind; die Verwendung von Ersatzstoffen ist nicht möglich
d Antifoulingfarben auf der Basis zinnorganischer Verbindungen für Schiffe.
II 6 6
Für welche der folgenden Stoffe bestehen nach der Chemikalien-Verbotsverordnung Verbote für das Inverkehrbringen an private Endverbraucher?
a krebserzeugende Stoffe
b Fluorchlorkohlenwasserstoffe
c benzolhaltige Treibstoffe
d hochentzündliche Stoffe
II 6 7
Für welche der folgenden Stoffe bestehen nach der Chemikalien-Verbotsverordnung Verbote für das Inverkehrbringen?
a erbgutverändernde Stoffe
b radioaktive Stoffe
c Quecksilberverbindungen
d Arsenverbindungen
II 6 8
Welche Gefahrstoffe dürfen nach der Chemikalien-Verbotsverordnungnichtin den Verkehr gebracht werden?
a Lösemittel mit einem Massengehalt von mehr als 0,1 % Benzol
b Wasch- und Reinigungsmittel mit 0,5 % Formaldehyd
c Quecksilberverbindungen als Holzschutzmittel
d mit Teerölen behandelte Eisenbahnschwellen für den privaten Verbrauch, sofern frische Schnittstellen dauerhaft versiegelt und abgedeckt sind.
II 6 9
Unter folgenden Voraussetzungen dürfen mit Teeröl behandelte Eisenbahnschwellen, Leitungsmasten und Pfähle erneut in Verkehr gebracht werden:
a Für den privaten Bereich, sofern bestimmte Grenzwerte eingehalten werden.
b Frische Schnittstellen müssen auf jeden Fall versiegelt werden.
c Für Innenräume, sofern sie anschließend verkleidet werden.
d Sofern sie für den ursprünglichen Verwendungszweck verwendet werden.
II 6 10
Für welche der folgenden Stoffe gelten Verbote nach Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-VO)?
a Phosphorwasserstoff
b E 605 (Parathion)
c gefährliche, flüssige Stoffe oder Gemische in Dekorationsgegenständen, die zur Erzeugung von Licht- oder Farbeffekten (durch Phasenwechsel), z.B. in Stimmungslampen und Aschenbechern bestimmt sind
d Cadmium
II 6 11
Für welche der folgenden Stoffe bestehen nach der Chemikalien-Verbotsverordnung Verbote für das Inverkehrbringen?
a Bleichromate
b aromatische Amine
c flüssige gefährliche Stoffe in Spielzeug
d alle Zinnverbindungen
II 6 12
Zu welchen Zwecken dürfen Gefahrstoffe, die Arsenverbindungen enthalten,nichtin den Verkehr gebracht werden?
a als Holzschutzmittel im Freien
b Kupfer-Chromarsenate zum industriellen Behandeln von Eisenbahnschwellen
c als Wasseraufbereitungsmittel
d als Antifoulingfarbe
II 6 13
Zu welchem Zweck dürfen bleisulfat- und bleicarbonathaltige Farben in Verkehr gebracht werden?
a für Innenraumdekoration.
b für Gestaltung von Aufenthaltsräumen.
c für originalgetreue Restauration von Denkmalen oder denkmalgeschützten Gebäudeteilen.
d Sie dürfen überhaupt nicht eingesetzt werden.
II 6 14
Für welche der folgenden Stoffe bestehen nach dem Anhang zu § 1 Chemikalien-Verbotsverordnung Verbote für das Inverkehrbringen?
a Asbest
b alle giftigen Stoffe und sehr giftigen Stoffe
c Benzol
d Teeröle
II 6 15
Für welchen der folgenden Stoffe gibt es im Anhang zu § 1 Chemikalien-Verbotsverordnung Verbote für das Inverkehrbringen?
a Phosphorwasserstoff
b Natriumchlorid
c Formaldehyd
d Dioxine
II 6 16
Für welchen der folgenden Stoffe gibt es im Anhang zu § 1 Chemikalien-Verbotsverordnung Verbote für das Inverkehrbringen?
a Benzol
b Cadmium
c Bleisulfat
d Tetrachlorkohlenstoff
II 6 17
Tetrachlorkohlenstoff darf als Fleckenwasser
a nicht in den Verkehr gebracht werden.
b nur an Privatpersonen nicht abgegeben werden.
c erst nach Zulassung durch das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) in den Verkehr gelangen.
d nur in Portionen unter 125 ml in den Verkehr gelangen.
II 6 18
Ein Kunde verlangt von Ihnen 200 ml wässrige Formaldehyd-Lösung (40 %). Welche Pflicht muss beachtet werden?
Beachten Sie beim Lösen die beiliegende Liste!
a Das Gefäß muss richtig gekennzeichnet sein.
b Der Kunde muss einen erlaubten Verwendungszweck angeben.
c Dieser Vorgang muss schriftlich festgehalten werden.
d Keine, die Lösung darf nicht abgegeben werden.
II 6 19
Für welches der nachfolgenden Gemische oder Erzeugnisse ist das Inverkehrbringen verboten?
a Waschmittel mit einem Gehalt von 0,1 % Formaldehyd
b Uhrarmbänder aus Leder mit einem Gehalt von 0,1 % Pentachlorphenol
c Feuerlöscher, dessen Löschmittel 0,1 % Halone enthält
d Filterpapier mit einem Gehalt von 0, 1 ppm PCDD
II 6 20
Für welche der nachfolgend aufgeführten gefährlichen Stoffe / Stoffgruppen regelt die Chemikalien-Verbotsverordnung das Inverkehrbringen von Stoffen/Erzeugnissen?
a Flammschutzmittel
b Chromathaltiger Zement
c Alkylphenole
d Azofarbstoffe
II 6 21
Für welche der folgenden Stoffe / Stoffgruppen bestehen nach dem Anhang zu § 1 Chemikalien-Verbotsverordnung Verbote für das Inverkehrbringen?
a Alkylphenole
b Kaliumpermanganat
c Chromathaltiger Zement
d Teeröle
II 6 22
Welche Stoffe dürfen nicht in Haushaltreinigern verwendet werden?
a Alkylphenole
b Kochsalz
c Soda
d Essigsäure
II 6 23
Für welche der folgenden Stoffe / Stoffgruppen bestehen nach dem Anhang zu § 1 Chemikalien-Verbotsverordnung Verbote für das Inverkehrbringen?
a Kurzkettige Chlorparaffine
b Kupfersulfat
c Chromathaltiger Zement
d Azofarbstoffe
II 6 24
Welche Ausnahme für das Inverkehrbringen von Benzol und Gemischen mit einem Massengehalt von 0, 1 % und größer existiert?
a Einsatz als Treibstoff in Verbrennungsmotoren
b Einsatz in Industrieanlagen in geschlossenen Systemen
c Einsatz als Verdünnungsmittel für Lacke
d Einsatz als Reinigungsmittel
II 6 25
Welcher Stoff darf in Mengen > 0,1 Masse-% nicht in Klebstoffen und Sprühfarben für private Endverbraucher Verwendung finden
a Toluol
b Ethylacetat
c Isopropanol
d Essigsäure
II 6 26
Für welchen der folgenden Stoffe / Stoffgruppen besteht / bestehen nach dem Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-VO) ein Verbot für das Inverkehrbringen?
a Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
b Kaliumpermanganat
c Toluol
d 1,2,4-Trichlorbenzol
II 6 27
Ein Händler importiert Fahrradreparatursets aus China. Was hat er aus chemikalienrechtlicher Sicht zu beachten?
a Er muss die Einhaltung der Verpackungs- und Kennzeichnungsvorschriften sicherstellen.
b Gummilösung mit einem Benzolgehalt von 0,1 % oder mehr darf nicht in den Verkehr gebracht werden.
c Der Benzolgehalt ist nicht beschränkt, da die Gummilösung in einer Tube zum Verkauf angeboten wird.
d Es gibt keinerlei Beschränkungen.
II 6 28
Ein Händler importiert Thermosgefäße. Bei der Anlieferungskontrolle wird festgestellt, dass Abstandshalter aus Weißasbest (Chrysotil) verwendet wurden. Was ist richtig?
a Die Thermosgefäße dürfen in den Verkehr gebracht werden, weil das potenzielle Füllgut konstruktionsbedingt nicht mit dem Weißasbest in Kontakt kommt.
b Die Thermosgefäße dürfen auf Grund des enthaltenen Chrysotil nicht in den Verkehr gebracht werden,
c Es existieren keine Beschränkungen.
d Chrysotil durfte befristet bis Dezember 2010 für Isolationszwecke verwendet werden.
II 6 29
Ein Supermarkt verkauft Textilreiniger, der Trichlorethylen enthält. Welche Aussage ist richtig?
a Bei Verwendung einer Verpackung mit kindergesichertem Verschluss ist der Textilreiniger im Einzelhandel verkaufsfähig.
b Der Kunde muss über die mit der Verwendung verbundenen Gefahren informiert werden.
c Es existieren keine Beschränkungen.
d Trichlorethylen ist als krebserzeugenden Stoff Kategorie 2 eingestuft. Die Abgabe an private Endverbraucher ist verboten.
II 6 30
Das Herstellen, Inverkehrbringen und Verwenden von Teerölen zum Holzschutz ist beschränkt. Welche Inhaltsstoffe von Teerölen erfordern diese Beschränkung?
a aliphatische Chlorkohlenwasserstoffe
b Benzo(a)pyren
c polychlorierte Biphenyle (PCB)
d polyaromatische Kohlenwasserstoffe
GFK II Nr. 7 - Vertiefte Kenntnisse des Gefahrstoffrechts / CLP-VO 1272/2008
II 7 1
In einem Lagerraum finden Sie einen Behälter, der Salzsäure enthält. Leider ist das Schild mit der Konzentrationsangabe nicht mehr lesbar. Der Behälter ist aber mit dem Gefährlichkeitsmerkmal reizend gekennzeichnet. Welche Konzentration hat eine auf diese Art gekennzeichnete Salzsäurelösung?
Beachten Sie beim Lösen die beiliegende Liste!
a 0,02 - 2 %
b 2 - 5 %
c 10 - 25 %
d über 25 %
II 7 2
Das Definitionsprinzip im Gefahrstoffrecht
a ist nur zur Einstufung von gasförmigen Gemischen hinsichtlich ihrer physikalisch-chemischen Eigenschaften vorgesehen.
b ist ein Einstufungsprinzip, das benutzt wird für gefährliche Stoffe, die nicht nach dem Listenprinzip erfasst sind.
c hat absoluten Vorrang vor anderen Einstufungsmethoden.
d ist die einzige Möglichkeit, die toxikologischen Eigenschaften eines Gemisches zu bestimmen, die mehrere toxikologisch relevante Komponenten enthält.
II 7 3
Das Listenprinzip im Gefahrstoffrecht ermöglicht die Einstufung
a sämtlicher chemischer Stoffe.
b bestimmter gefährlicher Stoffe.
c sämtlicher gefährlicher Gemische.
d bestimmter gefährlicher Gemische.
II 7 4
Im Sinne der Gefahrstoffverordnung gilt ein Stoff mit einem Flammpunkt von 5°C und einem Siedepunkt von 55°C als
a hochentzündlich.
b leichtentzündlich.
c explosionsgefährlich.
d entzündlich.
II 7 5
Welcher Gefahrenklasse nach GHS sind alle diese genannten Stoffe zugehörig? Natriumchlorat, Kaliumpermanganat, Kaliumnitrit, Chromtrioxid
Beachten Sie beim Lösen die beiliegende Liste!
a Akute Toxozität
b Entzündbare Gase
c auf Metalle korrosiv wirkend
d Entzündend (oxidierend) wirkende Feststoffe
II 7 6
In welche Kategorie wird ein Stoff nach der Gefahrstoffverordnung eingeteilt, der als krebserzeugend eingestuft ist?
a Kategorie 0
b Kategorie 2
c Kategorie III B
d Kategorie 1
II 7 7
Welche wässrigen Lösungen folgender Stoffe sind nach der CLP-Verordnung alswirkt Ätzend/Reizend auf die Haut Kat. 1 B eingestuft?
Beachten Sie beim Lösen die beiliegende Liste!
a Essigsäure 50 %
b Silbernitrat 5 %
c Kaliumhydroxid 2 %
d Wasserstoffperoxid 3 %
II 7 8
Welches der nachfolgenden Metalle hat in metallischer Form bzw. in Form seiner Salze oder Oxide ein kanzerogenes Potenzial?
Beachten Sie beim Lösen die beiliegende Liste!
a Arsen
b Antimon
c Rubidium
d Nickel
II 7 9
Welcher der nachfolgenden Stoffe hat in metallischer Form bzw. in Form seiner Salze oder Oxide ein kanzerogenes Potenzial?
Beachten Sie beim Lösen die beiliegende Liste!
a Cadmium
b Selen
c Chrom
d Arsen
II 7 10
Welche Kennzeichnung muss bei MDI-haltigen PU-Montageschäumen auf der Verpackung angegeben sein, wenn auch Propan als Treibmittel enthalten ist?
a Hochentzündlich (F+) und Giftig (T)
b Leichtentzündlich (F) und sehr Giftig (T+)
c Hochentzündlich (F+) und Gesundheitsschädlich (Xn)
d Brandfördernd (O) und Ätzend (C)
II 7 11
Kriterien und Anforderungen für die Einstufung von gefährlichen Stoffen und Gemischen findet man
a im Anhang VI RL 67/548/EWG.
b in RL 1999/45/EG .
c im Anhang zum Chemikaliengesetz.
d für Pflanzenschutzmittel im Pflanzenschutzgesetz.
II 7 12
Kriterien und Anforderungen für die Einstufung und Kennzeichnung von gefährlichen Stoffen und Gemischen findet man
a in der VO (EG) Nr. 1272/2008 ( CLP-Verordnung) Titel II und III.
b im Anhang VI Tabelle 3.1 VO (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung).
c im Anhang zum Chemikaliengesetz.
d für Pflanzenschutzmittel im Pflanzenschutzgesetz.
II 7 13
Welche der folgenden Stoffe sind nach der CLP-Verordnung als Akut toxisch eingestuft?
Beachten Sie beim Lösen die beiliegende Liste!
a Arsenverbindungen
b Lindan
c Natriumchlorat
d Benzo(a)pyren
II 7 14
Von welcher Methanol-Konzentration an ist ein Lösemittel aus Methanol und Ethanol als Akut toxisch einzustufen und zu kennzeichnen?
Beachten Sie beim Lösen die beiliegende Liste!
a ab 50 %
b ab 25 %
c ab 10 %
d ab 3 %
II 7 15
Welches Erzeugnis darf nicht hergestellt oder verwendet werden, wenn es Asbest enthält?
a Spielzeug
b Pulver, aus denen Heimwerker Spachtelmasse bereiten
c Dichtungen
d Bodenbeläge
II 7 16
Benzol (5 % in Mischung mit Ethylalkohol) darf in einem Gewerbebetrieb
a zum Entfetten von Oberflächen verwendet werden.
b als Lösemittel für herzustellende Schuhpflegemittel verwendet werden.
c als Lösemittel für Klebstoffe verwendet werden.
d für Lehr- und Ausbildungszwecke verwendet werden.
II 7 17
Wann dürfen Sie für einen Kunden Bleichlauge in eine Lebensmittelflasche (z.B. Sprudelflasche) abfüllen?
a Gar nicht.
b Wenn die Flasche zuvor richtig und vollständig gekennzeichnet wurde.
c Wenn die Flasche keine sichtbaren Schäden (z.B. Sprünge) aufweist.
d Wenn der Kunde älter als 18 Jahre und sachkundig im Umgang mit Gefahrstoffen ist.
II 7 18
Wie müssen gefährliche Stoffe und Gemische verpackt sein?
a Die Verpackung muss so ausgelegt und beschaffen sein, dass der Inhalt nicht austreten kann.
b Sie dürfen nicht in Behältnissen verpackt sein, durch deren Form oder Bezeichnung der Inhalt mit Lebensmitteln, Futtermitteln, Arzneimitteln oder Kosmetika verwechselt werden kann.
c Die Verpackungen dürfen nicht die aktive Neugier von Kindern wecken oder die Verbraucher irreführen.
d Eine vorschriftsmäßige Transportverpackung darf auch bei Tätigkeiten verwendet werden.
II 7 19
Darf für einen Kunden ein Gefahrstoff in eine mitgebrachte Flasche abgefüllt werden?
a Ja, wenn die Flasche zuvor richtig und vollständig gekennzeichnet wird.
b Ja, wenn die Flasche keine sichtbaren Schäden (Sprünge) aufweist.
c Nur wenn keine Verwechslung mit einer Getränkeflasche möglich ist.
d Nein, das Abfüllen in mitgebrachte Behältnisse ist grundsätzlich nicht zulässig.
II 7 20
Welche Aussage zur Verpackung und Kennzeichnung von Gefahrstoffen ist richtig?
a Es gibt keine speziellen Anforderungen an Verpackung und Kennzeichnung.
b Bei brandfördernden, leichtentzündlichen, entzündlichen oder reizenden Gefahrstoffen kann die Angabe der R- und S-Sätze entfallen, wenn die Verpackung nicht mehr als 1,25 Liter enthält.
c Die verkehrsrechtlichen Gefahrensymbole sind generell durch die Gefahrensymbole und die zugehörigen Gefahrenbezeichnungen der Gefahrstoffverordnung zu ersetzen.
d Stoffe, Gemische und Erzeugnisse, die aus Deutschland in Staaten außerhalb der EU und des EWR verbracht werden, müssen nicht nach den Vorschriften der Gefahrstoffverordnung verpackt und gekennzeichnet sein.
II 7 21
Welche Anforderung stellt die Gefahrstoffverordnung an die Verpackung gefährlicher Stoffe und Gemische?
a Die Verpackung muss eine vorgegebene charakteristische Form aufweisen.
b Die Verpackung darf nicht zu Verwechselungen mit Lebensmitteln Anlass geben.
c Der Werkstoff der Verpackung darf nicht mit dem Stoff bzw. dem Gemisch reagieren.
d Das Verpackungsmaterial muss eine bestimmte Farbe aufweisen.
II 7 22
Dürfen Gefahrstoffe in anderen als den Originalbehältnissen aufbewahrt und abgegeben werden?
a Pflanzenschutzmittel generell nicht
b ja, wenn anschließend eine Verpackung und Kennzeichnung entsprechend der Gefahrstoffverordnung erfolgt
c nur, wenn die Behältnisse keine Verwechslung mit Trink- oder Essgefäßen zulassen
d alle Gefahrstoffe nicht
II 7 23
Gibt es für die Größe der Kennzeichnung gefährlicher Stoffe konkrete Vorschriften?
a Die Größe der Kennzeichnung kann entsprechend der Verpackung frei gewählt werden.
b Die Größe muss mindestens 5 % der Verpackungsoberfläche einnehmen.
c In Abhängigkeit vom Rauminhalt der Verpackung werden Mindestformate vorgeschrieben.
d Die Kennzeichnung nach Gefahrstoffverordnung muss mindestens gleich groß sein, wie die Kennzeichnung nach den Transportvorschriften.
II 7 24
Wie ist ein Gemisch, welches 5 % Methanol enthält, nach der VO (EG) Nr. 1272/2008 richtig zu kennzeichnen?
Beachten Sie beim Lösen die beiliegende Liste!
a Flam. Liq. 1
b keine Kennzeichnung erforderlich
c STOT SE 2 H371
d F, T, R 11 -23/25
II 7 25
Welche Aussage zur Kennzeichnung gefährlicher Stoffe und Gemische ist falsch?
a Eine Mindestgröße der Kennzeichnung ist bei Gefäßen bis 500 ml nicht vorgeschrieben.
b Die Kennzeichnung muss deutlich abgefasst, haltbar und in deutscher Sprache abgefasst sein.
c Die Kennzeichnung darf unter bestimmten Voraussetzungen auf einem mit der Verpackung verbundenen Schild angebracht werden.
d Die Kennzeichnung muss generell nur auf einer Seite der Verpackung angebracht werden.
II 7 26
Wie müssen asbesthaltige Erzeugnisse nach der VO (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-VO) gekennzeichnet werden?
a als giftig
b als krebserzeugend
c nach besonderen Vorschriften, unter anderem mit einem hellen "a" auf dunklem Grund
d nur asbesthaltige Gemische müssen gekennzeichnet werden, Erzeugnisse nicht
II 7 27
Besondere Kennzeichnungsvorschriften bestehen u. a. für
a asbesthaltige Erzeugnisse.
b Formaldehyd abgebende Erzeugnisse.
c Aerosoldosen ("Spraydosen").
d bleihaltige Gemische.
II 7 28
Für welche Erzeugnisse bzw. Gemische bestehen besondere Kennzeichnungsvorschriften?
a Formaldehydabgebende Erzeugnisse
b Pentachlorphenol (PCP) und PCP-haltige Gemische
c Zinkphosphathaltige Gemische
d Epoxidhaltige Gemische
II 7 29
Bei welchen Gemischen dürfen bei Kennzeichnung nach der VO (EG) Nr. 1272/2008 die H- und P-Sätze fehlen, wenn die Verpackung nicht mehr als 125 ml enthält?
a bei oxidierenden Gasen Kategorie 1
b bei Gasen unter Druck
c bei hautreizenden Gemischen Kategorie 1
d bei entzündbaren Flüssigkeiten der Kategorie 2
II 7 30
Muss ein Gemisch als "Giftig" gekennzeichnet werden, so kann, falls die Stoffliste nichts anderes vorsieht,
a das Gefahrensymbol "Reizend" entfallen.
b das Gefahrensymbol "Ätzend" entfallen.
c das Gefahrensymbol "Brandfördernd" entfallen.
d keine der vorstehend aufgeführten Kennzeichnungen entfallen.
II 7 31
Wovor warnen die H-Sätze der 200er Reihe
a vor Umweltgefahren
b vor Physikalischen Gefahren
c vor Gesundheitsgefahren
d vor Chemischen Gefahren
II 7 32
Wann dürfen bei Kennzeichnung nach der VO (EG) Nr. 1272/2008 die H- und P- Sätze fehlen, wenn die Verpackung nicht mehr als 125 ml enthält?
a bei Gasen unter Druck
b bei oxidierenden Feststoffen der Kategorie 1
c bei entzündbaren Feststoffen der Kategorie 1
d bei augenreizenden Stoffen der Kategorie 1
II 7 33
Der Hinweis "Irreversibler Schaden möglich" weist auf
a mögliche bleibende Gesundheitsschäden hin.
b mögliche krebserzeugende Wirkung hin.
c die Gefahr, besonders schwerwiegender, schlecht heilbarer Verletzungen hin.
d mögliche erbgutverändernde Wirkung hin.
II 7 34
Wovor warnen die H- Sätze der 300er Reihe?
a vor physikalischen Gefahren
b vor Gesundheitsgefahren
c vor Umweltgefahren
d vor Gewässerverunreinigungen
II 7 35
Wovor warnt der R-Satz "Gefahr kumulativer Wirkungen"?
a Das Gemisch hat mehrere, mindestens drei, gefährliche Eigenschaften.
b Das Gemisch hat gefährliche Eigenschaften, die an den Gefahrensymbolen nicht zu erkennen sind.
c Das Gemisch ist möglicherweise krebserzeugend.
d Das Gemisch kann sich im menschlichen Körper anreichern und ihn möglicherweise schädigen.
II 7 36
Der Satz R 24/25 "Giftig bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken" ist bei welchem der folgenden Gefahrstoffe anzugeben?
Beachten Sie beim Lösen die beiliegende Liste!
a Oxalsäure
b Phenol
c Hexachlorophen
d Quecksilber
II 7 37
Was muss bei der Kennzeichnung von Lösemittelmischungen nach der Richtlinie 1999/45/EG, deren Einzelbestandteile jeweils in der Gefahrstoffverordnung aufgeführt sind, beachtet werden?
a Es müssen alle für die Einzelsubstanzen verwendeten Gefahrensymbole und Bezeichnungen verwendet werden.
b Die erforderlichen Gefahrensymbole und Bezeichnungen können über eine Berechnung und/oder physikalisch-chemische Daten ermittelt werden.
c Es sind Gefahrensymbole und Bezeichnungen des in höchster Konzentration enthaltenen Gefahrstoffes zu übernehmen.
d Es gibt keine bestimmte Regelung.
II 7 38
Welcher Stoff oder welches Gemisch ist hautätzend Kategorie 1 B bei Kennzeichnung nach der VO (EG) Nr. 1272/2008?
Beachten Sie beim Lösen die beiliegende Liste!
a Methyltrichlorsilan 1 %
b Fluorwasserstoffsäure 2 %
c Cyclohexylamin 4 %
d Morpholin 15 %
II 7 39
Welcher der folgenden Stoffe ist akut toxisch Kat. 2 bei Kennzeichnung nach der VO (EG) Nr. 1272/2008?
Beachten Sie beim Lösen die beiliegende Liste!
a Kaliumnitrit 1 %
b Fluorwasserstoffsäure 0,5 %
c Methacrylnitril 1,5 %
d Bleitetraethyl 0,1 %
II 7 40
Welches der folgenden Gemische ist gesundheitsschädlich bei Kennzeichnung nach der Richtlinie 1999/45/EG ?
Beachten Sie beim Lösen die beiliegende Liste!
a Kaliumnitrit 1 %
b Fluorwasserstoffsäure 0,5 %
c Methacrylnitril 1,5 %
d Bleitetraethyl 0,1 %
II 7 41
Welches der folgenden Gemische ist ätzend bei Kennzeichnung nach der Richtlinie 1999/45/EG ?
Beachten Sie beim Lösen die beiliegende Liste!
a Methyltrichlorsilan 1 %
b Fluorwasserstoffsäure 0,5 %
c Cyclohexylamin 4 %
d Morpholin 15 %
II 7 42
Bei der Ermittlung der Einstufung eines Gemisches nach Anhang VI RL 67/548/EWG ergeben sich für das Gemisch mehrere Gefahrensymbole, nämlich T, Xi, C und F. Welches der Gefahrensymbole kann im Allgemeinen entfallen?
a T
b Xi
c C
d F
II 7 43
Für welche Stoffe und Gemische bestehen spezielle stoffspezifische zusätzliche Kennzeichnungspflichten?
a Benzol und benzolhaltige Gemische
b cyanacrylathaltige Gemische
c cadmiumhaltige Gemische
d arsenhaltige Gemische
II 7 44
Wie kann man die Gefahrensymbole bestimmen, mit denen Lösemittelmischungen gekennzeichnet werden müssen, deren Einzelbestandteile jeweils als Gefahrstoffe eingestuft sind?
a Indem man alle für die Einzelsubstanzen erforderlichen Gefahrensymbole verwendet.
b Indem man die erforderlichen Gefahrensymbole über eine Berechnung ermittelt.
c Indem man die in der VO (EG) Nr. 440/2008 beschriebenen Messungen oder Versuche durchführt.
d Indem man das Gefahrensymbol des in höchster Konzentration enthaltenen Gefahrstoffes übernimmt.
II 7 45
Um ein Gemisch einzustufen, das eine Komponente mit toxischen Eigenschaften enthält, existieren bestimmte Konzentrationsgrenzen, die überschritten sein müssen, damit der Inhaltsstoff eine Einstufung des Gemisches als Gefahrstoff zur Folge hat. Welche Konzentrationsgrenze ist für flüssige und feste Gemische richtig?
a 0,1 % für sehr giftige Inhaltsstoffe
b 1 % für giftige Inhaltsstoffe
c 10 % für giftige Inhaltsstoffe
d 1 % für gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe
II 7 46
Bei der Einstufung von Gemischen nach der Richtlinie 1999/45/EG ist folgendes zu beachten:
a Die Einstufung der Gemische muss anhand von vorgegebenen Prüfungen erfolgen.
b Die Einstufung als explosionsgefährlich, brandfördernd, hochentzündlich, leichtentzündlich oder entzündlich erfolgt aufgrund vorgegebener Prüfungen.
c Anforderungen für die Einstufung und Kennzeichnung gefährlicher Gemische finden sich in der Verordnung (EG) Nr. 440/2008.
d Gemische ohne gefährliche Inhaltsstoffe sind keine Gefahrstoffe.
II 7 47
Die Einstufung von Gemischen nach der "konventionellen Methode" (eine Rechenmethode) nach der Richtlinie 1999/45/EG
a ist eine Möglichkeit für die Einstufung von Gemischen aufgrund toxischer Eigenschaften.
b ist eine Methode zur Einstufung bislang nicht eingestufter Stoffe.
c ist eine Möglichkeit für die Einstufung von Gemischen aufgrund physikalisch chemischer Eigenschaften.
d ist eine Möglichkeit der Einstufung von Gemischen unter Verwendung von Konzentrationsgrenzen für die Einzelkomponenten.
II 7 48
Stufen Sie die Giftigkeit eines Lösemittels nach der Richtlinie 1999/45/EG ein, das zu 1% aus Nitrobenzol, zu 6% aus Chlorpropan, zu 3% aus Toluol und zu 90% aus Ethanol besteht! Das Gemisch ist
Beachten Sie beim Lösen die beiliegende Liste!
a sehr giftig.
b giftig.
c gesundheitsschädlich.
d Keines dieser Gefährlichkeitsmerkmale trifft zu.
II 7 49
Entspricht dieses Schild den Kennzeichnungsvorschriften der CLP-Verordnung [VO (EG) Nr. 1272/2008]?
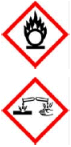 |
Salpetersäure 100 % (007-004-00-1) |
|
| Kann Brand verstärken; Oxydationsmittel | H272 | |
| Von Kleidung/ ... /brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren. | P220 | |
| Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P260 P280 |
|
| BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P303+361+353 | |
| BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P305+351+338 | |
| Firma Mustermann AG Firmenstraße 3 80200 München +49(0) 89 12345 |
a Ja.
b Nein, das Signalwort "Gefahr" fehlt.
c Nein, es fehlt die Menge des Stoffes.
d Nein, es fehlt der Gefahrenhinweis "Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden".
II 7 50
Entspricht dieses Schild den Kennzeichnungsvorschriften der CLP-Verordnung [VO (EG) Nr. 1272/2008]?
 |
Methanol (603-001 -00-X) |
||
| Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H225 | ||
| Giftig bei Einatmen. Schädigt die Augen - Erblindungsgefahr. |
H331 H370 |
||
| Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. | P210 | ||
| Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P403+233 P280 |
||
| BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. | P302+352 P301+310 |
||
| Unter Verschluss aufbewahren. | P405 | ||
| Firma Mustermann AG | 20L | ||
a Ja.
b Nein, die vollständige Anschrift und Telefonnummer des Herstellers fehlt.
c Nein, es fehlt die Menge des Stoffes.
d Nein, es fehlen die Gefahrenhinweise "Giftig bei Verschlucken und "Giftig bei Hautkontakt".
II 7 51
Entspricht dieses Schild den Kennzeichnungsvorschriften der CLP-Verordnung [VO (EG) Nr. 1272/2008]?
 |
Methanol (603-001 -00-X) |
||
| Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H225 | ||
| Giftig bei Verschlucken. | H301 | ||
| Giftig bei Hautkontakt. | H311 | ||
| Giftig bei Einatmen. | H331 | ||
| Schädigt die Augen - Erblindungsgefahr. | H370 | ||
| Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. | P403+233 | ||
| Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P280 | ||
| BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. | P302+352 | ||
| BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. | P301+310 | ||
| Unter Verschluss aufbewahren. | P405 | ||
| Firma Mustermann AG Firmenstraße 3 80200 München +49(0) 89 12345 |
20L | ||
a Ja.
b Nein, die vollständige Anschrift und Telefonnummer des Herstellers fehlt.
c Nein, es fehlt das Gefahrenpiktogramm GHS06 "Totenkopf mit gekreuzten Knochen".
d Nein, es fehlt der Sicherheitshinweis "Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen".
II 7 52
Entspricht dieses Schild den Kennzeichnungsvorschriften der CLP-Verordnung [VO (EG) Nr. 1272/2008]?
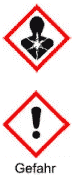 |
Toluol (601-021-00-3) |
||
| Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H304 | ||
| Verursacht Hautreizungen. | H315 | ||
| Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H336 | ||
| Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. | H361 d | ||
| Kann bei Einatmen die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition | H373 | ||
| Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. | P210 | ||
| Behälter dicht verschlossen halten. | P233 | ||
| Explosionsgeschützte elektrische Anlagen/Lüftungsanlagen/ Beleuchtungsanlagen/ ... /verwenden. | P241 | ||
| Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P280 | ||
| BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. | P301+310 | ||
| KEIN Erbrechen herbeiführen. | P331 | ||
| Firma Mustermann AG Firmenstraße 3 80200 München +49(0) 89 12345 |
20L | ||
a Ja.
b Nein, es fehlt das Gefahrenpiktogramm GHS02 "Flamme".
c Nein, es fehlt der Gefahrenhinweis H225 "Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar".
d Nein, die vollständige Anschrift und Telefonnummer des Herstellers fehlt.
II 7 53
Entspricht dieses Schild den Kennzeichnungsvorschriften der CLP-Verordnung [VO (EG) Nr. 1272/2008]?
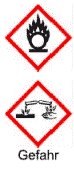 |
Salpetersäure 100 % | |
| Kann Brand verstärken; Oxydationsmittel | H272 | |
| Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H314 | |
| Von Kleidung/ ... /brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren. | P220 | |
| Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P260 | |
| Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P280 | |
| BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P303+361+353 | |
| BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P305+351+338 | |
| Firma Mustermann AG Firmenstraße 3
80200 München +49(0) 89 12345 |
a Ja.
b Nein, es fehlt ein Produktidentifikator (Indexnummer Anhang VI Teil 3).
c Nein, es fehlt die Mengenangabe.
d Nein, die vollständige Anschrift und Telefonnummer des Herstellers fehlt.
II 7 54
Bau- und Montageschäume, die MDI enthalten, müssen mit R40 gekennzeichnet sein. Dieser R-Satz bedeutet:
a Verdacht auf krebserzeugende Wirkung
b Kann Krebs erzeugen
c Kann Krebs erzeugen beim Einatmen
d Gesundheitsschädlich beim Einatmen
II 7 55
In PU-Montageschäumen ist MDI (Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat) enthalten. Mit welchem Gefahrensymbol und welchem Gefahrenhinweis müssen MDI-haltige Montageschäume gekennzeichnet sein?
a mit dem Gefahrensymbol gesundheitsschädlich
b mit dem Gefahrensymbol sehr giftig
c mit dem R-Satz 40 (Verdacht auf krebserzeugende Wirkung)
d mit dem R-Satz 45 (kann Krebs erzeugen)
II 7 56
In PU-Montageschäumen ist MDI (Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat) enthalten. Mit welchem Gefahrensymbol und welchem Gefahrenhinweis müssen MDI-haltige Montageschäume gekennzeichnet sein?
a mit dem R-Satz 40 (Verdacht auf krebserzeugende Wirkung)
b mit dem R-Satz 49 (kann Krebs erzeugen beim Einatmen)
c mit dem Gefahrensymbol gesundheitsschädlich
d mit dem Gefahrensymbol giftig
II 7 57
Ab welchem Gehalt an freiem MDI ist die Kennzeichnung von Bau- und Montageschäumen mit dem R- Satz 40 (Verdacht auf krebserzeugende Wirkung) erforderlich:
a 0,5 %
b 0,3 %
c 0,2 %
d 1 %
II 7 58
Welche mögliche Gefahr für die Gesundheit besteht beim Umgang mit MDI-haltigen Montageschäumen, wenn der Gehalt an freiem MDI im Produkt z.B. mehr als 10 % beträgt?
Verwenden Sie hierfür die beigefügte Stoffliste!
a Verursacht Verätzungen (R34)
b Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut (R36/37/38)
c Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich (R42/43)
d Verdacht auf krebserzeugende Wirkung (R40)
II 7 59
In PU-Montageschäumen ist MDI (Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat) enthalten. Mit welchem Gefahrensymbol müssen MDI-haltige Montageschäume nach der RL 67/548 EG gekennzeichnet sein?
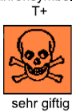 a |
 b |
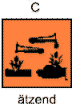
c |

d |
II 7 60
Welche mögliche Gefahr für die Gesundheit besteht beim Umgang mit MDI-haltigen Montageschäumen wenn der Gehalt an freiem MDI im Produkt z.B. mehr als 10 % beträgt?
Verwenden Sie hierfür die beigefügte Stoffliste!
a Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden (H314)
b Verursacht Hautreizungen und schwere Augenreizung, kann die Atemwege reizen. (H315 / H319 / H335)
c Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden und allergische Hautreaktionen verursachen (H334 / H317)
d Kann vermutlich Krebs erzeugen (H351)
GFK II Nr. 8 - Vertiefte Kenntnisse über einige Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS)
II 8 1
Die Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 510 enthalten Vorschriften für das Lagern von Gefahrstoffen. Sie gelten für das
a Lagern von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern
b Lagern radioaktiver Stoffe
c Lagern von Schüttgütern
d Be- und Umfüllen von Gefahrstoffen
II 8 2
Die Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 510 enthalten Vorschriften für das Lagern von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern. Sie gelten für das
a Ein- und Auslagern
b Transportieren innerhalb des Lagers
c Beseitigen freigesetzter Gefahrstoffe
d Be- und Umfüllen von Gefahrstoffen
II 8 3
Die Technischen Regeln für Gefahrstoffe TRGS 510 enthalten Vorschriften für das Lagern von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern. Welche Anforderungen werden an die Behälter/Verpackungen gestellt?
a keine Verwechslungsgefahr mit Lebensmittelbehältnissen
b bestimmte Größe
c bestimmte Gestalt
d vom Inhalt darf nichts nach außen dringen
II 8 4
Welches sind gemäß der Technischen Regeln für Gefahrstoffe TRGS 510 für das Lagern nicht geeignete Lagerorte und -räume?
a Verkehrswege
b Pausen-, Bereitschafts-, Sanitärräume
c Lagerschränke
d Container
II 8 5
Welche Gefährdungen können sich nach den Technischen Regeln für Gefahrstoffe TRGS 510 durch das Lagern von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern ergeben?
a Art und Eigenschaften der Stoffe
b Menge der Stoffe
c Zusammenlagerung der Stoffe
d klimatische Verhältnisse
II 8 6
Welche Grundsätze gelten gemäß der Technischen Regeln für Gefahrstoffe TRGS 510 für das Lagern von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern?
a sachgerechte Gestaltung und Einrichtung des Lagers
b Vermeidung des unbeabsichtigten Freisetzens von Gefahrstoffen
c Rauchverbot
d Verbot der Einnahme von Speisen und Getränken
II 8 7
Welche Anforderungen werden nach den Technischen Regeln für Gefahrstoffe TRGS 510 an ein Gefahrstoffverzeichnis nach GefStoffV für ein Lager gestellt:
a Bezeichnung der Gefahrstoffe
b Gefahrstoffmenge
c Behälterart
d Lagerbereich
II 8 8
Existieren nach den Technischen Regeln für Gefahrstoffe TRGS 510 Mengenschwellen für bestimmte Gefahrstoffklassen, die zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen erfordern:
a nein
b 200 kg für akut toxische Stoffe
c 200 kg für entzündbare und oxidierende Gase
d 200 kg für Gase unter Druck
II 8 9
Unter welchen Bedingungen ist gemäß TRGS 510 die Zusammenlagerung von Gefahrstoffen erlaubt?
a Zusammenlagerung ist möglich wenn hierdurch keine Gefährdungserhöhung entsteht
b Zusammenlagerung ist immer möglich
c Bei ausreichender räumlicher Trennung
d Nach Aussagen der Zusammenlagerungstabelle.
II 8 10
Folgendezusätzliche organisatorische Maßnahmen sind für das Lagern von akut toxischen Flüssigkeiten und Feststoffen nach der TRGS 510 erforderlich:
a Lagerung in einem abgeschlossenen Chemikalienschrank
b Lagerung in einem abschließbaren Gebäude
c Lagerung im Abzug
d Lager im Freien mit einem Mindestabstand von fünf Metern zu Gebäudeöffnungen
II 8 11
Folgendezusätzliche Brandschutzmaßnahmen sind für das Lagern von akut toxischen Flüssigkeiten und Feststoffen nach der TRGS 510 erforderlich:
a Bei Lagerung in Gebäuden sind die Lagerabschnitte gegenüber anderen Lagerabschnitten, anderen Räumen oder Gebäuden durch feuerbeständige Wände und Decken aus nichtbrennbaren Baustoffen (Feuerwiderstandsdauer mindestens 90 min) abzutrennen
b Lager in Gebäuden mit einer Lagermenge von mehr als 20 t pro Lagerabschnitt sind mit automatischen Brandmeldeanlagen auszurüsten
c Es sind ausreichend Löschmittel zur Verfügung zu stellen
d Es müssen Sprinkleranlagen installiert werden
II 8 12
Folgendezusätzliche organisatorische Maßnahmen sind für das Lagern oxidierender Flüssigkeiten und Feststoffe nach der TRGS 510 erforderlich:
a Die Lagerräume dürfen grundsätzlich keine Bodenabläufe haben
b Die Lagerräume dürfen keine Fenster haben
c Im Lagerraum dürfen keine mit Verbrennungsmotoren betriebenen Geräte oder Kraftfahrzeuge abgestellt werden
d Brennbare Materialien, die keine Lagergüter sind, dürfen im Lager nicht gelagert werden
II 8 13
Die TRGS 510 gilt für ebenfalls für das Lagern von Gasen unter Druck. Welchezusätzlichen Maßnahmen sind dazu notwendig
a Es dürfen keine offenen Verbindungen zu tiefer liegenden Räumen, Kanälen Abgüssen ohne Verschluss existieren
b Es müssen Bauteile feuerbeständig sein, wenn in angrenzenden Räumen, die nicht dem Lagern von Gasen dienen, Brand- oder Explosionsgefahr besteht
c Im Lager dürfen Gase nicht umgefüllt werden
d Die gemeinsame Lagerung von Gasen und Chemikalien ist verboten.
II 8 14
Für welche Lagerklassen gemäß TRGS 510 existiert ein prinzipielles Zusammenlagerungsverbot mit anderen Lagerklassen?
a Stark oxidierend wirkende Stoffe
b Brennbare Stoffe
c Explosive Stoffe
d Brennbare ätzende Stoffe
II 8 15
Welche Aussagen zur Lagerung von Gefahrstoffen gemäß TRGS 510 sind zutreffend?
a Die Zusammenlagerung von nichtbrennbaren Feststoffen mit brennbaren Feststoffen ist erlaubt.
b Die Zusammenlagerung von brennbaren ätzenden Stoffen mit stark oxidierenden wirkenden Stoffen ist erlaubt.
c Die Zusammenlagerung von Gasen mit nicht brennbaren ätzenden Stoffen ist erlaubt.
d Die Zusammenlagerung von brennbaren Stoffen mit Gasen ist erlaubt.
GFK III Nr. 1 - Physikalische und chemische Eigenschaften
III 1 1
Was versteht man unter dem Begriff Formulierung?
a eine Form der schriftlichen Gebrauchsanleitung
b Zubereitung, Aufbereitung eines Wirkstoffes als anwendungsfertiges Produkt, z.B. in fester oder flüssiger Form
c eine Verpackungsform
d eine Verpackungsaufschrift
III 1 2
Was ist eine Suspension?
a eine Flüssigkeit, die in Wasser völlig gelöst ist
b eine Flüssigkeit, die einen Stoff in winzigen Flüssigkeitströpfchen fein verteilt enthält
c eine Flüssigkeit, die einen Stoff in fester Form fein verteilt enthält
d eine Flüssigkeit, die völlig durchsichtig ist
III 1 3
Was ist eine Emulsion?
a eine Flüssigkeit, die einen Stoff in fester Form fein verteilt enthält
b eine Flüssigkeit, die einen Stoff in Form von flüssigen Teilchen fein verteilt enthält
c eine Flüssigkeit, die völlig durchsichtig ist
d eine Flüssigkeit, die einen Stoff in Wasser völlig gelöst enthält
III 1 4
Was versteht man unter dem Begriff "Ausflocken"?
a das Auflösen der Verpackung
b der Schutz der Innenverpackung durch Flocken
c die Trennung der verschiedenen Bestandteile
d die Reinigung des Behälters vor der Anwendung
GFK III Nr. 2 - Grundkenntnisse der Toxikologie
III 2 1
Antikoagulantien sind
a blutgerinnungsfördernde Substanzen.
b blutgerinnungshemmende Substanzen.
c blutbildungshemmende Substanzen.
d cumarinähnlich wirkende Mittel.
III 2 2
Haben giftige Mittel auch höhere gefährliche Rückstände?
a ja
b Sie sind nur beim langsamen Abbau gefährlich.
c Es gibt keinen direkten Zusammenhang.
d Das hängt von der Anwendung ab.
III 2 3
Ein Kontaktgift ist ein Mittel, das
a in erster Linie durch Berührung in den Körper eindringt.
b in erster Linie nach Aufnahme durch den Magen-Darm-Trakt wirkt.
c seine Wirkung erst nach Kontakt mit einem weiteren Stoff (Wirkungsverstärker) entfaltet.
d in erster Linie über die Atemwege wirkt.
III 2 4
Nach der Spritzarbeit treten beim Anwender Übelkeit, Kopfschmerzen, Schwindel auf. Was ist zu tun?
a Warme Milch oder Alkohol verabreichen.
b Sofort Arzt verständigen und ihm die Gebrauchsanleitung des eingesetzten Präparates vorlegen.
c Kopfschmerztabletten verabreichen.
d Erbrechen auslösen.
III 2 5
Ein Pflanzenschutzmittel bzw. ein Biozidprodukt ist mit dem Gefahrenhinweis "H 317" gekennzeichnet. Was ist richtig?
a Der H-Satz weist auf eine Gesundheitsgefahr hin.
b Der H-Satz bedeutet: "Schädlich für Wasserorganismen"
c Der H-Satz bedeutet: "Kann allergische Hautreaktionen verursachen".
d Der H-Satz weist auf eine Umweltgefahr hin.
III 2 6
Welche Eigenschaften haben organische Phosphorsäureesterverbindungen (z.B. Dichlorvos)?
a Sie werden im Körper erst nach Jahren abgebaut.
b Die meisten Phosphorsäureesterverbindungen sind giftig.
c Bei Vergiftungen wird der Tod durch Atemlähmung oder Herzversagen verursacht.
d Sie können über die Haut resorbiert werden.
III 2 7
Selektive Wirkung eines Herbizids ist die
a vorbeugende Wirkung.
b Wirkung nur auf bestimmte Pflanzenteile.
c Wirkung auf alle Pflanzen.
d Wirkung auf eine bestimmte Pflanzenart oder -gattung (auslesende Wirkung).
III 2 8
Was sind Synergisten?
a Gegengifte gegen systemische Pflanzenschutzmittel
b Personen, die berufsmäßig Pflanzenschutzmittel anwenden
c resistente Insekten
d Wirkstoffverstärker
III 2 9
Bestimmte Herbizide können zu Vergiftungen mit irreversiblen Schäden führen. Welches Mittel bzw. welcher Wirkstoff gehört in diese Gruppe?
a Glufosinat (Basta)
b Isoproturon (Arelon top)
c Thiophanat-ethyl (Cercobin FL)
d Glyphosat (Roundup Ultra)
III 2 10
Was bedeutet der Begriff phytotoxisch?
a eine schädigende Wirkung auf Pflanzen
b eine giftige Einwirkung auf den menschlichen Körper
c mäßig giftig
d besonders giftig
III 2 11
Auf welchem Wirkungsmechanismus beruht die Anwendung warfarinhaltiger Präparate als Rodentizide?
a Blockierung wichtiger Funktionen des Nervensystems
b Hemmung der Fortpflanzung
c Hemmung der Blutgerinnung
d Atemlähmung
III 2 12
Antikoagulantien sind die Blutgerinnung hemmende Wirkstoffe. Sie werden in Rodentiziden eingesetzt. Welche der aufgeführten Wirkstoffe hemmen die Blutgerinnung?
a Calciumcarbid
b Chlorphacinon
c Calciumphosphid
d Warfarin
III 2 13
Was ist ein systemisches Pflanzenschutzmittel?
a ein Produkt, das nur mit System und in Verbindung mit einem zweiten Produkt wirkt
b ein Präparat, das in den Saftstrom der Pflanze gelangt und mit diesem transportiert wird
c ein Insektenbekämpfungsmittel mit besonderem Dosierungssystem
d ein Präparat, das ausschließlich auf das Nervensystem von Insekten wirkt
III 2 14
Wie können schädigende Wirkstoffe aus Pflanzenschutzmitteln oder Biozidprodukten in den menschlichen Körper gelangen?
a nur durch Verschlucken
b durch Verschlucken, Einatmen und durch die Haut
c nur oral und inhalativ
d nur durch die Haut
III 2 15
Der ADI-Wert ist
a die duldbare tägliche Aufnahmemenge.
b der Grenzwert für die völlige Rückstandsfreiheit von Lebensmitteln.
c die allgemeine Dosisbegrenzung für höchstzulässige Reste von Giftstoffen auf Lebensmitteln.
d ein allgemeiner Dosis-Wirkungs-Indikator.
III 2 16
Was versteht man unter dem Begriff chronische Toxizität eines Pflanzenschutzmittels oder Biozidproduktes?
a die Förderung zusätzlicher Krankheiten beim Menschen
b das Auslösen allergischer Reaktionen
c die Giftwirkung bei wiederholter Aufnahme über einen längeren Zeitraum
d die Langzeitwirkung des Mittels gegen die Schadursache
III 2 17
Was versteht man unter dem Begriff akute Toxizität eines Pflanzenschutzmittels oder Biozidproduktes?
a die unmittelbare Giftwirkung nach Aufnahme
b das Auslösen allergischer Reaktionen bei der Pflanze
c die Giftigkeit einer frisch angerührten Spritzbrühe
d die Giftwirkung über einen längeren Zeitraum nach der Aufnahme
III 2 18
Wartezeiten werden zumeist in Tagen angegeben. Was bedeutet der Buchstabe F an Stelle einer Angabe von Tagen?
a Die Wartezeit des Mittels ist durch die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen vorgesehener Anwendung und normaler Ernte verbleibt.
b Für derart gekennzeichnete Mittel ist bislang keine Wartezeit festgelegt worden.
c Die Anwendung solcher Mittel ist bislang nur im Frühjahr vorgesehen.
d Er bezieht sich auf Futterpflanzen.
III 2 19
Ein Pflanzenschutzmittel bzw. ein Biozidprodukt ist mit den Gefahrenhinweisen "H 350" und "H 360" gekennzeichnet. Was ist richtig?
a Die H-Sätze weisen auf Umweltgefahren und physikalische Gefahren hin.
b Die H-Sätze weisen auf Gesundheitsgefahren hin.
c Die Gefahrenhinweise bedeuten "Kann Krebs erzeugen" und "Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen".
d Die Gefahrenhinweise bedeuten " Entzündbares Aerosol" und "Schädigt die Umwelt durch Ozonabbau".
III 2 20
Was bedeutet der H-Satz 373?
a Das betreffende Präparat kann hautreizend wirken.
b Es besteht lediglich eine Gefahr bei der Anwendung des Präparates durch Schwangere und stillende Mütter.
c Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
d Der betreffende Wirkstoff kann die Wirkung bestimmter anderer Stoffe verstärken.
GFK III Nr. 3 - Wirkungen von Biozidprodukten und Pflanzenschutzmitteln auf die Umwelt
III 3 1
Ordnen Sie den Fachausdruck Persistenz den stichpunktartigen Erläuterungen zu:
a Durchdringung, Durchgang von Stoffen durch Membranen / Materialien
b Anreicherung von Stoffen, Speicherung
c genetisch bedingte Widerstandsfähigkeit
d Beständigkeit von Stoffen in der Umwelt
III 3 2
Ein Wirkstoff wird in der Umwelt nur schwer abgebaut. Der Fachausdruck dafür ist
a Resistenz.
b Persistenz.
c Konsistenz.
d Subsistenz.
III 3 3
Welcher Gefahrenhinweis (H-Satz) kennzeichnet Umweltgefahren?
a H 400- Sehr giftig für Wasserorganismen
b H 300- Lebensgefahr bei Verschlucken
c H-290- Kann gegenüber Metallen korrosiv sein
d H- 420-Schädigt die öffentliche Gesundheit und die Umwelt durch Ozonabbau in der äußeren Atmosphäre
III 3 4
Resistenz ist die
a Widerstandsfähigkeit von Schadorganismen
b Dauer der Wirksamkeit eines Mittels nach der Anwendung
c leichte Bekämpfung von Schaderregern
d die ererbte Widerstandsfähigkeit von Kulturpflanzen
III 3 5
Auf welchen Flächen dürfen Pflanzenschutzmittel ohne Sondergenehmigung angewendet werden?
a Auf landwirtschaftlichen oder gärtnerisch genutzten Freilandflächen
b Auf befestigten Hof- und Betriebsflächen
c Auf Gleisanlagen
d An Gewässern
III 3 6
Worüber informieren die Sicherheitshinweise (P-Sätze) "P 501 " und "P 502" auf der Verpackung eines Pflanzenschutzmittels oder Biozidproduktes?
a Sicherheitshinweise zur Entsorgung
b Sicherheitshinweise zur Aufbewahrung
c Sicherheitshinweise zur Aufbewahrung unter Verschluss und zum Lagerort (z.B. kühl und gut gelüftet)
d Sicherheitshinweise zur Wiederverwendung/Wiederverwertung und zur Entsorgung von Inhalt/Behälter
III 3 7
Welche Vorschriften gelten für den Schutz von Bienen?
a Bienengefährliche Pflanzenschutzmittel dürfen nicht an blühenden Beständen angewandt werden.
b Im Umkreis von 10 km um einen amtlich registrierten Bienenstock dürfen keine Pflanzenschutzmittel angewandt werden.
c Spritzmaßnahmen, bei denen bienengefährliche Substanzen verwendet werden, müssen beim zuständigen Ordnungsamt gemeldet werden.
d Wenn blühende Bestände mit bienengefährlichen Pflanzenschutzmitteln behandelt werden, so soll dies in den Abendstunden erfolgen, da der Bienenflug dann abnimmt.
III 3 8
Wie lassen sich schädliche Wirkungen von Pflanzenschutzmitteln oder Biozidprodukten auf die Umwelt vermeiden?
a Anwendung nach Gebrauchsanweisung
b Einhaltung der Sicherheitshinweise (P-Sätze) und Gefahrenhinweise (H-Sätze)
c Anwendung nicht zugelassener Pflanzenschutzmittel oder Biozidprodukte, da von diesen keine Umweltgefahren ausgehen
d Anwendung im Freien nur, wenn es die Witterungsbedingungen zulassen (z.B. Windstille)
III 3 9
Dürfen Herbizide auf Garageneinfahrten, Dächern oder Plattenwegen eingesetzt werden?
a mit Zulassung der Gemeindeverwaltung
b Es besteht keine Regelung.
c Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf befestigten Freilandflächen und auf sonstigen Freilandflächen, die weder landwirtschaftlich noch forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzt werden, ist verboten.
d Es besteht die Möglichkeit, in begründeten Fällen bei der zuständigen Behörde eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen.
III 3 10
Wie kann bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln deren Eintrag in Oberflächengewässer verhindert werden?
a durch Verringerung der Wasseraufwandmenge
b durch Spritzung bei Windstille
c durch Erhöhung des Spritzdrucks
d durch Einhaltung von Gewässerabstandsauflagen
III 3 11
Für die Verwendung von Antikoagulanzien als Rodentizide werden aus Gründen des Umweltschutzes und Resistenzmanagements Beschränkungen in der biozidrechtlichen Zulassung erteilt. Welche Aussage ist richtig?
a Die Anwendung von Rodentiziden mit Wirkstoffen der 2. Generation wird im Wesentlichen auf berufsmäßige Anwender mit Sachkunde oder Schädlingsbekämpfer beschränkt.
b Rodentizide Wirkstoffe der 2. Generation sind z.B. "Difenacoum" oder "Brodifacoum".
c Rodentizide Wirkstoffe der 1. Generation sind z.B. "Chlorphacinon", Coumatetralyl" oder "Warfarin".
d Es gibt keine Unterschiede bei den Anwendungsbeschränkungen für Antikoagulanzien mit Wirkstoffen der 1. oder 2. Generation.
III 3 12
Bei den bioziden Wirkstoffen in zugelassenen Antikoagulanzien zur Bekämpfung von Ratten und Mäusen unterscheidet man Wirkstoffe der 1. und der 2. Generation. Welche Aussage ist richtig?
a Mittel mit Wirkstoffen der 1. Generation dürfen auch durch nicht Sachkundige angewendet werden.
b Die Anwendung von Mitteln mit Wirkstoffen der 2. Generation durch private Verbraucher ist aus Umweltschutzgründen und zur Vermeidung von Resistenzentwicklungen nicht erlaubt.
c Rodentizide mit den Wirkstoffen "Bromadiolon", Difethialon" oder "Floucomafen" dürfen durch private Verbraucher angewendet werden.
d Wirkstoffe der 2. Generation sind giftiger als Wirkstoffe der 1. Generation, bei Wirkstoffen der 2. Generation reicht in der Regel eine einmalige Köderaufnahme.
III 3 13
Was ist unter dem Begriff Naturhaushalt zu verstehen?
a die nach dem Bundesnaturschutzgesetz besonders geschützten Arten (Pflanzen und Tiere der roten Liste)
b die finanziellen Aufwendungen der öffentlichen Haushalte für Zwecke des Natur- und Artenschutzes
c Boden, Wasser und Luft sowie Tier- und Pflanzenwelt und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen
d die Stoffkreisläufe der Natur
III 3 14
Dürfen Pflanzenschutzmittel in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern oder Küstengewässern angewandt werden?
a ja
b nur zum Hochwasserschutz
c generell nein; im Ausnahmefall kann die zuständige Behörde eine Genehmigung erteilen
d keine fischgiftigen Präparate, andere Mittel ja
III 3 15
In welchem Umkreis von Bienenständen dürfen bienengefährliche Pflanzenschutzmittel während des täglichen Bienenflugs grundsätzlich nicht oder nur mit Genehmigung des Bienenhalters ausgebracht werden?
a 60 m
b 20 m
c 100 m
d 500 m
III 3 16
Wann gilt ein Pflanzenbestand im Sinne der Bienenschutzverordnung als blühend?
a Wenn sich mindestens 50 % der Blüten geöffnet haben.
b Wenn sich die erste Blüte zu öffnen beginnt.
c Wenn sich 10 bis 15 % der Blüten geöffnet haben.
d Wenn sich alle Blüten geöffnet haben.
III 3 17
Welche der genannten Punkte sind bei der Ausbringung bienengefährlicher Pflanzenschutzmittel zu beachten?
a Sie dürfen nicht auf blühende Pflanzen appliziert werden.
b Die Anwendung muss so erfolgen, dass blühende Pflanzen nicht mitgetroffen werden.
c Die Ausbringung ist ohne Einschränkung möglich.
d Im Umkreis von 60 m um Bienenstände ist die Ausbringung während des täglichen Bienenflugs nur mit Zustimmung des Imkers zulässig.
III 3 18
Wie sind bienengefährliche Pflanzenschutzmittel gekennzeichnet?
a durch die Aufschrift "honiggefährlich" auf der Packung
b Bienengefährliche Mittel haben eine gelb-schwarze Beschriftung.
c durch auf der Packung gelb abgebildete Bienen auf weißem, schwarz umrandeten Untergrund
d durch die Aufschrift "Mittel ist bienengefährlich"(B1)
III 3 19
Auf welchen Flächen ist die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln nicht erlaubt?
a auf Feldrainen, Böschungen und Wegrändern
b in Hopfengärten und Hausgärten
c auf Grünland und im Weinbau
d zur Rekultivierung von Stilllegungsflächen
III 3 20
Warum dürfen nur zugelassene Pflanzenschutzmittel in den Verkehr gebracht und angewendet werden?
a Nur sie erfüllen die strengen Anforderungen hinsichtlich Wirksamkeit und Kulturpflanzenverträglichkeit sowie Schutz vor Gefahren für Mensch, Tier und Naturhaushalt.
b Nur sie sind im Inland hergestellt und kaufmännisch kalkuliert.
c Nur sie erfüllen die Forderung, nicht giftig und nicht in anderer Weise schädlich zu sein.
d nicht zugelassene Pflanzenschutzmittel können Schäden an Pflanzen verursachen.
III 3 21
Welche Aussagen treffen auf Pyrethrine (z.B. Spruzit Käferfrei) zu?
a Sie besitzen eine große Stabilität (Persistenz), sind also gegen Umwelteinflüsse sehr beständig und deshalb umweltrelevant.
b Pyrethrum wirkt stark fischgiftig; pyrethrinhaltige Pflanzenschutzmittel sind giftig für Algen, Fische und Fischnährtiere.
c Ein Vertreter ist das früher zugelassene Parathion (E 605 forte).
d Pyrethrine werden zur Schädlingsbekämpfung und im Pflanzenschutz eingesetzt.
III 3 22
Wie sind Restmengen von .Behandlungsflüssigkeiten umzugehen?
a Ablassen in die Kanalisation
b Restmengen 1 zu 10 verdünnen und auf der Behandlungsfläche ausbringen;
c Die Restmenge auf Kulturflächen ausbringen, da sie von den Bodenbakterien abgebaut werden.
d In der Spritze bis zur nächsten Behandlung stehen lassen.
 |
weiter . |  |
(Stand: 02.10.2018)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion
...
X
⍂
↑
↓