

 |
zurück |  |
3 Persönliche Schutzausrüstungen im Schornsteinfegerhandwerk
3.1 Kopfschutz
3.1.1 Bei der Rohbauabnahme, bei Arbeiten in Kesseln, engen Räumen usw. kann durch Anstoßen oder herabfallende Gegenstände die Gefahr von Kopfverletzungen bestehen; deshalb sind bei derartigen Tätigkeiten Schutzhelme zu tragen.
3.1.2 Bei der Gefährdungsermittlung sind die folgenden Möglichkeiten, durch die Kopfverletzungen auftreten können, zu berücksichtigen:
Bei allen Arbeiten und Tätigkeiten, die diese Gefährdungen beinhalten, sind Industrieschutzhelme, die den Grundanforderungen der DIN EN 397 genügen, zu tragen.
Für Schornsteinfeger wird ein Kinnriemen empfohlen.
3.1.3 Gemäß DIN EN 397 sind Schutzhelme gekennzeichnet durch eingeprägte oder eingegossene Informationen über
Falls er Kopf bei Tätigkeiten ausschließlich gegen Anstoßen an harte und auch spitze Gegenstände geschützt werden muss, ist die Benutzung einer Industrie-Anstoßkappe nach DIN EN 812 zweckmäßig. Diese dürfen aber auf Fall als Ersatz für einen Industrieschutzhelm verwendet werden.
3.1.4 Weitere Hinweise für Schutzhelme enthält die BG-Regel "Benutzung von Kopfschutz" (BGR 193).
3.2 Fußschutz
3.2.1 Schornsteinfeger sollten Berufsschuhe tragen. Diese sollten nach DIN EN 347 bzw. nach EN ISO 20.347 gefertigt sein. Berufsschuhe mit durchtrittsicherer Einlage sind zu empfehlen. Die Sohlen dürfen keinen Eisenbesatz an Spitze und Absatz haben und müssen für die Arbeit auf Dächern geeignet sein. Schnallenverschlüsse sind Schnüren als Schuhverschluss vorzuziehen.
3.2.2 Weitere Hinweise für den Fußschutz enthält BG-Regel "Benutzung von Fuß- und Beinschutz" (BGR 191).
3.3 Augen- und Gesichtsschutz
3.3.1 Beim Ausbrennen von Schornsteinen, bei der Kesselreinigung oder ähnliche Tätigkeiten sind die Augen bzw. das Gesicht vor Verletzungen zu schützen, wenn z.B. mit wegfliegenden Teilen, Gefährdungen durch Staub oder gefährlicher Strahlung zu rechnen ist.
3.3.2 Die Gefährdungsermittlung ist auf den wirkungsvollen Schutz des Auges zu richten. Mögliche Gefährdungen ergeben sich bei Schornsteinfegerarbeiten besonders durch mechanische Einwirkungen auf das Auge, gegen die Sicherheitssichtscheiben zu verwenden sind. Seltener treten optische, chemische oder thermische Einwirkungen auf, die den jeweils zweckmäßigen Augenschutz erfordern.
3.3.3 Weitere Hinweise für den Augen- und Gesichtsschutz enthält die BG-Regel "Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz" (BGR 192).
3.4 Atemschutz
3.4.1 Gefährdungen, Gefährdungsermittlung
3.4.1.1 Ob Atemschutz erforderlich ist, muss im Einzelfall geprüft werden. Bei normaler Messtätigkeit ist im Allgemeinen kein Atemschutz erforderlich. Bei der Reinigung von Schornsteinen, insbesondere aus Asbestzementrohren,
ist im Allgemeinen Atemschutz erforderlich.
3.4.1.2 Sauerstoffmangel oder gesundheitsgefährliche Gase, Dämpfe, Nebel oder Stäube können beim Menschen unmittelbar Benommenheit, Schwindel, Atemnot, Bewusstlosigkeit und Erstickungserscheinungen bis zum Tod bewirken.
Bei der Kehrarbeit freiwerdende lungengängige Partikel als Stäube, Rauch, Aerosole können krebserzeugend sein, z.B. Asbestfasern, Benzo(a)pyren.
3.4.1.3 Die Grenzwerte (GW) als höchstzulässige Konzentration von gefährlichen Gasen, Dämpfen, Nebeln oder Stäuben in der Umgebungsluft sind durch MAK-Werte (Max. Arbeitsplatz-Konzentrationswerte) bzw. TRK-Werten (Technische Richtkonzentration) festgelegt. Überall dort, wo gefährliche Gase und Stoffe auftreten können, sind vor Beginn der Arbeiten entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen.
In Zweifelsfällen ist die Prüfung mit Gasspürgeräten oder anderen Prüf- und Messgeräten durchzuführen. Werden die Grenzwerte (GW) als die höchstzulässige Konzentration an Schadstoff in der Umgebungsatmosphäre nicht eingehalten, sind geeignete Atemschutzgeräte einzusetzen.
3.4.2 Auswahl und Einsatz von Filtergeräten gegen Partikeln
3.4.2.1 Gegen Gefahrstoffe in Form von Stäuben oder Aerosolen wie z.B. Asbestfasern, Benzo(a)pyren, Rußpartikel, sind in der Regel Filtergeräte mit Partikelfiltern oder partikelfiltrierende Halbmasken als Atemschutz erforderlich. Geeignet sind Atemschutzgeräte der Schutzstufen P2/P3, da sie auch gegen krebserzeugende Gefahrstoffe schützen (siehe Tabelle 2). Bewährt haben sich Halbmasken mit Partikelfiltern der Klasse P2 oder P3 und partikelfilternde Halbmasken der Klasse FFP2 oder FFP3 die z.B. in einer am Anzugsgürtel befestigten Maskendose mitgeführt werden können.
Mundtücher sind keine persönlichen Schutzausrüstungen und bieten keinen ausreichenden Schutz.
3.4.2.2 Partikelfilter sind durch den Kennbuchstaben P, die Partikelfilterklasse und die Kennfarbe weiß (Filtergehäuse oder weißer Farbring auf farbneutralem Filtergehäuse) gekennzeichnet.
3.4.2.3 Partikelfilter werden entsprechend ihrem Abscheidevermögen für Partikeln in die Partikelfilterklassen P1 (geringes Abscheidevermögen), P2 (mittleres Abscheidevermögen) und P3 (hohes Abscheidevermögen) eingeteilt.
Bemerkung:
Gegen krebserzeugende Stäube und Tröpfchenaerosole ist nach der BG-Regel "Benutzung von Atemschutzgeräten" (BGR 190) mindestens die Schutzstufe P2 erforderlich. Hiernach ist auch eine partikelfiltrierende Halbmaske der Schutzstufe 2 = FFP2 zulässig.
Nach den Technischen Regel für Gefahrstoffe TRGS 519 "Asbest; Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten" ist für Instandhaltungsarbeiten ein Atemschutz mit der Schutzstufe P2 ausreichend, wenn 150 000 F/m3 in der Umgebungsluft nicht überschritten werden.
Nach den TRGS 519 sind auch partikelfiltrierende Halbmasken FFP2 bis zu einer Faserkonzentration bis 150.000 F/m3 zulässig.
Tabelle 2: Einsatz von Halbmaske und Viertelmaske mit Partikelfilter und von partikelfiltrierender Halbmaske
| Geräteart | Vielfaches des Grenzwertes (GW) | Bemerkungen, Einschränkungen |
| Halb-/Viertelmaske mit P2-Filter, partikelfiltrierende Halbmaske FFP 2 | 10 | Nicht gegen radioaktive Stoffe, Viren und Enzyme |
| Halb-/Viertelmaske mit P3- Filter, partikelfiltrierende Halbmaske FFP 3 | 30 |
Anmerkung:
Während für Vollmasken in der Regel Filter mit Standard-Rundgewinde Verwendung finden, werden in Halbmasken und Viertelmasken meist Filter mit Spezialgewinde oder nur für die entsprechende Filteraufnahme passende Steckfilter verwendet. Daher ist bei Halbmasken und Viertelmasken besonders darauf zu achten, nur die vom Gerätehersteller empfohlenen Filter einzusetzen.
3.4.2.4 Bei gleichzeitigem Auftreten von Gasen, Dämpfen und Partikeln sind geeignete Kombinationsfilter zu benutzen.
3.4.2.5 Der Einsatz von Filtergeräten setzt voraus, dass die Umgebungsatmosphäre mindestens 17 Vol.-% Sauerstoff enthält.
In Behältern, Schächten, Kanälen und anderen engen oder geschlossenen Räumen müssen deshalb in der Regel von der Umgebungsatmosphäre unabhängige Atemschutzgeräte verwendet werden.
Bild 1: Partikelfiltergerät mit Halbmaske, Filteraufnahme und Steckfilter

3.4.2.6 Das Zusetzen des Partikelfilters macht sich durch deutliche Erhöhung des Atemwiderstandes bemerkbar. Kombinationsfilter sind außerdem bei Wahrnehmung von Geruch, Geschmack oder Reizerscheinungen zu wechseln.
3.4.2.7 Die partikelfiltrierende Halbmaske ist ein vollständiges Atemschutzgerät, das ganz oder überwiegend aus dem Filtermaterial besteht, durch das die Einatemluft strömt oder bei dem der Hauptfilter einen untrennbaren Teil des Gerätes darstellt. Die Atemluft strömt entweder durch das Filtermaterial oder zusätzlich durch ein Ausatemventil ab.
Das Ausatemventil verringert den Ausatemwiderstand deutlich und sollte deshalb bevorzugt werden. Die Schutzfaktoren der Klassen FFP1, FFP2 und FFP3 entsprechen denen einer Halbmaske mit P1, P2 oder P3-Filtern und können wie diese verwendet werden.
3.4.2.8 Entscheidend für die Schutzwirkung des Atemschutzgerätes ist ein guter Dichtsitz des Atemanschlusses.
Personen mit Bärten und Koteletten im Bereich der Dichtlinien von Voll- und Halbmasken sind für das Tragen von Atemschutzgeräten ungeeignet.
Für Brillenträger gibt es beim Einsatz von Vollmasken spezielle Maskenbrillen.
Bild 2: Partikelfiltrierende Halbmaske

3.4.3 Untersuchung, Ausbildung, Unterweisung
3.4.3.1 Die Benutzung von Atemschutzgeräten bedeutet im Allgemeinen eine zusätzliche Belastung für den Träger. Überschreitet die Tragedauer der Filtergeräte 30 Minuten in einer Schicht, ist für den Gerätträger die Eignung nach festgelegten Grundsätzen durch eine Erstuntersuchung und regelmäßige Nachuntersuchungen festzustellen.
Auch für Träger von Filtergeräten sind bis auf wenige Ausnahmen arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen erforderlich.
Die Eignung für das Tragen von Atemschutzgeräten ist entsprechend der "Berufsgenossenschaftlichen Grundsätze für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen" G26 "Atemschutzgeräte" festzustellen.
3.4.3.2 Vor der ersten Benutzung von Atemschutzgeräten ist eine theoretische und praktische Grundausbildung erforderlich. Danach sind in regelmäßigen Zeitabständen Wiederholungsunterweisungen notwendig (siehe BG-Regel "Benutzung Atemschutzgeräten" (BGR 190).
3.4.3.3 § 14 der Gefahrstoffverordnung und die Technischen Regeln für Gefahrstoffe TRGS 555 "Unterweisung und Betriebsanweisung nach § 20 (jetzt § 14) GefStoffV" regeln die Ermittlungs- und Überwachungspflicht sowie die Unterweisung und Betriebsanweisung.
Es wird im Allgemeinen für ausreichend gehalten, im Arbeitsbuch diejenigen Kehrstellen zu kennzeichnen, die auf Grund ihrer Bauart, z.B. Asbestzementrohr, oder auf Grund ihrer Befeuerungsart (feste und flüssige Brennstoffe) bei der Kehrtätigkeit atemwegsgängige Stäube/Aerosole frei werden lassen und Atemschutz für den Schornsteinfeger erforderlich machen. Die Atemschutzmaske ist bei der Kehrtätigkeit mitzuführen, da atemwegsgängige Stäube/Aerosole auch unvermittelt auftreten können.
3.4.4 Der Unternehmer hat durch geeignete Maßnahmen ein einwandfreies Funktionieren der Atemschutzgeräte und die Einhaltung guter hygienischer Bedingungen zu gewährleisten.
Für Instandhalten, Prüfen, Lagern sind die Angaben der Hersteller zu beachten. Atemschutzgeräte können normalerweise mit Seifenlauge und gründlichem Nachspülen gereinigt werden. Das Desinfizieren mit Desinfektionsmitteln nach Herstellerangabe muss vor Übergabe des Gerätes an einen anderen Träger erfolgen.
Partikelfiltrierende Halbmasken sind für eine Desinfektion und Nutzung durch weitere Geräteträger nicht vorgesehen.
Die Lagerung muss trocken, staubgeschützt und verwechslungsfrei in geeigneten Behältern vorgenommen werden. Atemschutzgeräte oder Teile davon mit befristeter Lagerzeit, wie manche Filter oder Gummiteile, sind nach deren Ablauf der Verwendung zu entziehen.
3.4.5 Weitere Hinweise für den Atemschutz enthält die BG-Regel "Einsatz von Atemschutzgeräten" (BGR 190).
3.5 Schutzkleidung
3.5.1 Die von den Schornsteinfegern benutzte Arbeitskleidung ist eine berufsspezifische Arbeitskleidung ohne spezifische Schutzfunktion.
3.5.2 Als Schutzkleidung können erforderlich sein:
3.5.3 Dort, wo Schutzkleidung für den Schornsteinfeger erforderlich ist, muss sie den Anforderungen der EG Richtlinie 89/686/EWG ( 8. GPSGV) entsprechen (siehe Abschnitt 1.4).
3.5.4 Weitere Hinweise für Schutzkleidung enthält die BG-Regel "Einsatz von Schutzkleidung" (BGR 189).
3.6 Handschutz
3.6.1 Bei Schornsteinfegerarbeiten ist sehr oft die Gefahr von Handverletzungen gegeben, z.B. durch scharfe Kanten bei der Kehrtätigkeit, bei der Handhabung des Schultereisens, beim Ausbrennen oder ähnlichem; deshalb sind bei derartigen Tätigkeiten Schutzhandschuhe erforderlich.
Bei der Gefährdungsermittlung sind neben den Gefährdungen für die Hände durch äußere Einwirkungen auch die Gefährdungen für den Träger durch den Schutzhandschuh selbst und durch ungenügende Schutzwirkung zu berücksichtigen.
3.6.2 Gefährdungen für die Hände durch äußere Einwirkungen sind z.B.
Gefährdungen für den Träger durch den Schutzhandschuh können durch unzulänglichen Tragekomfort, schlechte Hautverträglichkeit und anderes eintreten. Gefährdungen durch ungenügende Schutzwirkung sind insbesondere durch falsche Auswahl und falsche Anwendung der Schutzhandschuhe gegeben.
3.6.3 Geeignete Schutzhandschuhe sind unter Angabe der Gefährdungen sowie Ursachen und Art der Gefährdungen beim Hersteller oder Lieferanten zu erfragen.
3.6.4 Anforderungen an Schutzhandschuhe und weitere Hinweise enthält die BG-Regel "Einsatz von Schutzhandschuhen" (BGR 195) oder können bei Schutzhandschuhherstellern erfragt werden.
3.7 Hautschutz
3.7.1 Hautschutzmittel gehören zu den persönlichen Schutzausrüstungen, allerdings ist keine CE-Kennzeichnung vorgeschrieben. Es ist ein auf die Gefährdungen abgestimmter Hautschutzplan zu erstellen.
Besondere Hautgefährdungen für die Schornsteinfeger entstehen z.B. durch stark hauthaftende Verschmutzungen und Arbeitsstoffe, wie Ruß, Staub, Altöl, Beschichtungsstoffe und ähnliches.
3.7.2 Hautschutz umfasst:
Alle drei Stufen sind gleich wichtig für die Verhütung von Hauterkrankungen.
Das Hautschutzmittel soll das Eindringen der Schadstoffe in die Haut und die Hautreinigung erleichtern. Es muss unbedingt auf die spezifische Hautgefährdung abgestimmt sein.
Ein falsches Hautschutzmittel kann die Gefährdung erhöhen, da hierdurch gegebenenfalls die Aufnahme von Schadstoffen gefördert werden kann.
Die Hautreinigung soll gründlich und gleichzeitig hautschonend sein. Die Zusammensetzung des Reinigungsmittels muss auf die Art und den Grad der Verschmutzung abgestimmt sein. Grundsätzlich sollte das mildeste Hauteinigungsmittel verwendet werden.
Verdünner, Waschbenzin, Trichlorethylen, Perchlorethylen, Kaltreiniger, Vergaserkraftstoff oder ähnliches sind zur Hautreinigung nicht zulässig.
Die regelmäßige Hautpflege unterstützt die natürliche Regeneration der Haut. Die Hautpflegemittel führen der Haut die Schutzstoffe wieder zu, welche ihr bei der Arbeit und durch die Hautreinigung entzogen werden.
3.7.3 Weitere Hinweise für den Hautschutz enthält die BG-Regel "Benutzung von Hautschutz" (BGR 197).
3.7.4 Geeignete Mittel für den Hautschutz können bei den Herstellern oder Lieferanten (s. Anhang) erfragt werden.
3.8 Persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz
3.8.1 Bei direkter Absturzgefahr, z.B. an freistehenden Schornsteinen, sind in der Regel persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz zu benutzen.
In diesem Fall ist das System zum Auffangen abstürzender Personen so zu wählen, dass bei einem Sturz das Auf- oder Anprallen auf/an ein Hindernis ausgeschlossen und die Fallstrecke möglichst gering ist.
3.8.2 Persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz sind Systeme zum Auffangen abstürzender Personen. Sie bestehen aus einem Auffanggurt und zusätzlichen Bestandteilen, z.B. Verbindungsmittel mit Falldämpfer, Höhensicherungsgerät.
Es ist ausschließlich das folgende System festgelegt:
3.8.3 Teile der persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz sind:
3.8.4 Auffanggurte
3.8.4.1 Je nach Art der Tätigkeit und der besonderen Gefahren im Absturzfall ist ein geeigneter Auffanggurt auszuwählen. Ein Auffanggurt besteht aus Gurtbändern, die den Körper umschließend im Beckenbereich und an den Schultern verlaufen.
Es gibt Auffanggurte mit vorderer, hinterer Fangöse und Steigschutzösen sowie zusätzlichen seitlichen Halteösen. Halteösen an Auffanggurten dürfen nicht für Auffangfunktionen benutzt werden.
Bei Bild 3 handelt es sich um eine beispielhafte Darstellung für einen Auffanggurt zur Verwendung an einer Steigschutzeinrichtung
Bild 3: Auffanggurt mit rückseitiger Fangöse, und einer vorderen Steigschutzöse; Rückenstütze bzw. Rückenpolster ist vorhanden
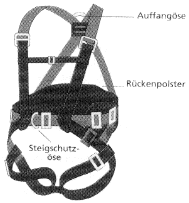
3.8.4.2 Falls Auffanggurte in Verbindung mit Steigschutzeinrichtungen benutzt werden sollen, müssen diese mit einer vorderen Steigschutzöse (am Bauchgurt) ausgerüstet sein (siehe Bild 3).
3.8.5 Mitlaufende Auffangeräte einschließlich fester Führung (Steigschutzeinrichtungen)
3.8.5.1 Steigschutzeinrichtungen sind Teile der persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz. Sie sichern Personen, die mit einem Auffanggurt und einer Zwischenverbindung an dem mitlaufenden Auffanggerät angeschlagen sind, gegen Absturz.
3.8.5.2 Steigschutzeinrichtungen für Steigleitern oder Steigeisengänge werden in unterschiedlichen Ausführungen mit festen Führungen (Schienen oder Seilen) angeboten. Dabei wird zwischen mitlaufenden Auffanggeräten mit oder ohne horizontaler Zugkraft, die der Steigende in horizontaler Richtung aufzubringen hat, unterschieden.
3.8.5.3 Durch die Verwendung von Falldämpfern oder energieabsorbierenden Einzelteilen bzw. energieabsorbierender Funktion des Auffanggerätes werden die Stoßkräfte auf höchstens 6 kN reduziert.
3.8.5.4 Bei der Benutzung von Steigschutzeinrichtungen ist die vordere Steigschutzöse (am Bauchgurt) direkt an der Zwischenverbindung (ohne zusätzliche Teile) anzuschließen. Die Länge der Zwischenverbindung - zwischen Auffanggerät und Steigschutzöse des Auffanggurtes - darf nicht verändert werden, da sonst die sichere Funktion des Auffanggerätes nicht gewährleistet ist.
Bild 4: Beispiel für eine Steigschutzeinrichtung

3.8.6 Beschädigte oder durch Sturz beanspruchte persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz sind der Benutzung zu entziehen, bis ein Sachkundiger der weiteren Benutzung zugestimmt hat.
3.8.7 Für den Fall eines Sturzes ist durch geeignete Maßnahmen eine unverzügliche Rettung zu gewährleisten. Durch längeres Hängen im Gurt können Gesundheitsgefahren auftreten.
Bei längerem Hängen im Auffanggurt besteht die Gefahr des Hängetraumas (orthostatischer Schock). Durch plötzliche Flachlagerung besteht akute Lebensgefahr infolge Herzüberlastung bzw. Nierenversagen.
3.8.9 Prüfung
3.8.9.1 Persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz und zum Retten müssen nach Bedarf, mindestens jedoch einmal jährlich, auf ihren einwandfreien Zustand durch einen Sachkundigen geprüft werden.
3.8.9.2 Feste Führungen (Schienen) von Steigschutzeinrichtungen hat der Betreiber dieser Einrichtung, wenn nicht kürzere Fristen festgelegt sind, nach Bedarf auf ihren einwandfreien Zustand durch einen Sachkundigen prüfen zu lassen.
3.8.10 Betriebsanweisung, Unterweisung
3.8.10.1Betriebsanweisung
Für die Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz und zum Retten hat der Unternehmer eine Betriebsanweisung zu erstellen.
3.8.10.2 Unterweisung
Der Unternehmer hat die Beschäftigten vor der ersten Benutzung und nach Bedarf, mindestens jedoch einmal jährlich zu unterweisen. Für die Verwendung von persönlichen Schutzausrüstungen zum Retten umfasst die Unterweisung auch praktische Übungen.
3.8.11 Reinigung, Aufbewahrung
Das mitlaufende Auffanggerät, das Verbindungsmittel, der Auffanggurt sowie der persönlichen Schutzausrüstungen zum Retten sind nach Bedarf zu reinigen und gegen schädigende Einflüsse geschützt aufzubewahren.
Weitere Hinweise für persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz bzw. zum Retten enthalten die BG-Regeln
4 Beratung
Zur Beratung stehen Ihnen die Technischen Aufsichtsdienste Ihrer Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft zur Verfügung.
| Berufsgenossenschaftliche Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit: (BG-Regel) | Anhang 1 |
| Hersteller von Persönlichen Schutzausrüstungen | Anhang 2 |
(Stand 1/2005)
Dieses Verzeichnis informiert über Hersteller als Bezugsquellen von persönlichen Schutzausrüstungen. Es werden aus Platzgründen nur Hersteller oder bei ausländischen Herstellern ein Importeur aufgenommen. Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auch solche Hersteller, die hier nicht genannt sind, können sicherheitstechnisch einwandfreie Erzeugnisse liefern.
Es ist keine Gewähr dafür gegeben, dass die hier angeführten Hersteller ausschließlich sicherheitstechnisch einwandfreie Erzeugnisse liefern. Es wird daher empfohlen, sich vom Hersteller bzw. Lieferer die Konformitätsbescheinigung, die Herstellerinformation und bei Produkten der Kategorie II oder III die EG-Baumusterprüfbescheinigung vorlegen zu lassen. Persönliche Schutzausrüstungen müssen mit der CE-Kennzeichnung versehen sein (siehe Abschnitt 1.4 dieser BG-Information). Nur so kann gewährleistet werden, dass das Erzeugnis der 8. GPSGV (Achte Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz, Verordnung über das Inverkehrbringen von Persönlichen Schutzausrüstungen) entspricht.
Auskünfte in allen Fragen hinsichtlich Beschaffung und Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen erteilt der Fachausschuss "Persönliche Schutzausrüstungen" mit Sitz im Zentrum für Sicherheitstechnik der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Zwengenberger Straße 68, 42.781 Haan.
| 1. | Schutzhelme - Kopfschutz |
| 3 M Deutschland GmbH, Abt. Arbeits- und Umweltschutz, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss | |
| Fondermann GmbH, Protector Technologies, Max-Vollmer-Straße 14, 40724 Hilden | |
| Lockweiler Werke GmbH, Pappelweg 10, 66687 Wadern | |
| AEARO GmbH, Ottostraße 1, 76275 Ettlingen | |
| Schuberth Helme GmbH, Postfach 44 38, 38034 Braunschweig | |
| UVEX Arbeitsschutz GmbH & Co. KG, Postfach 25 42, 90715 Fürth | |
| Voss-Helme GmbH & Co. KG, Kokenhorststraße 8, 30938 Burgwedel | |
| ENHa GmbH, Kasteler Straße 11, 66620 Nonnweiler | |
| Edelrid-Edelmann + Ridder GmbH & Co. KG, Acheuer Weg 66, 88316 Isny im Allgäu | |
| Christoph & Markus Krah GmbH; Brauhausstraße 19, 82467 Garmisch-Partenkirchen | |
| 2. | Fußschutz |
| Atlas Schuhfabrik, Gebr. Schabsky GmbH & Co. KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund | |
| Baltes Schuhfabrik GmbH & Co. KG, Borsigstraße 62, 52525 Heinsberg | |
| Baak GmbH, Theodor-Heuss-Straße 1 a, 47179 Duisburg | |
| Franz Dressen Schuhfabrik, Schusterweg 3, 52525 Heinsberg | |
| van Elten GmbH, Ostwall 7 - 9, 47589 Uedem | |
| Freudenberg Schuh GmbH "NORA", Hoffmannallee 41 - 51, 47533 Kleve | |
| HAIX Schuhfabrik, Ebrantshauser Straße 6, 84048 Mainburg | |
| Hanrath Schuhfabrik, Jägerstraße 14 -16, 52525 Heinsberg | |
| Jalatte-Vertrieb, Gewerbeallee 20, 45478 Mülheim / Ruhr | |
| Heinr. Klumpen Söhne GmbH & Co. KG, Fabrikation von Arbeitsschutzschuhen, Natt 18, 41334 Nettetal | |
| L. Priebs GmbH & Co. KG, Schutzschuhfabrik Lupriflex, Annabergstraße 46, 45721 Haltern | |
| Lupos Schuhfabrik GmbH, Rheinstraße 12, 41836 Hückelhoven | |
| Nießen Schuhfabrik GmbH STARFLEX, Sootstraße 102, 52525 Heinsberg | |
| Otter Schutz GmbH, Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb Persönlicher Schutzausrüstung, Xantener Straße 6, 45479 Mülheim/Ruhr | |
| Heinrich Schraven KG Schuhfabrik, Gocher Straße 4, 47589 Uedem | |
| Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden | |
| UVEX Arbeitsschutz GmbH & Co. KG, Würzburger Straße 189, 90766 Fürth | |
| 3. | Augenschutz |
| AEARO (ehemals E-A-R Arbeitsschutz GmbH und Peltor GmbH), Einsteinstr. 47, 76275 Ettlingen | |
| Auergesellschaft GmbH, Thiemannstraße 1, 12059 Berlin | |
| Dalloz Safety GmbH, Kronsforder Allee 16, 23560 Lübeck | |
| EKASTU Erwin Klein GmbH, Gutenbergstraße 75, 70197 Stuttgart | |
| GIa mbH, Postfach 10 08 45, 44708 Bochum | |
| KIND Arbeitssicherheit, Postfach 12 63, 30938 Burgwedel | |
| Dr. Kurt Korsing GmbH & Co., Abt. 7/Arbeitsschutz, Postfach 60 04 80, 50726 Köln | |
| Lasogard Arbeitsschutz-Produkte GmbH, Pappelweg 8-10, 66687 Wadern | |
| OPMa Arbeitsschutz GmbH, Postfach 80, 91444 Emskirchen | |
| Georg Schmerler, Schutzbrillen- u. Optische Fabrik GmbH & Co. KG, Reitweg 7, 90587 Veitsbronn | |
| UVEX Arbeitsschutz GmbH & Co. KG, Postfach 25 42, 90715 Fürth |
 |
weiter . |  |
(Stand: 15.09.2022)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion